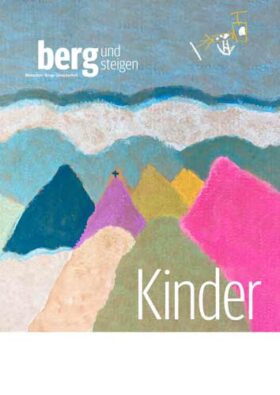Über Frauen, die auf Berge steigen
Zugegeben: Wenn wir uns die Geschichte des Alpinismus ganz herkömmlich als eine sportliche Leistungsgeschichte ansehen, nehmen die Bergsteigerinnen nicht die allerersten Positionen ein. Doch ist das Bergsteigen – und auch das Klettern im engeren Sinn – nicht ganz einfach Sport, sondern auch ein soziokulturelles Phänomen, das sich im Laufe der letzten paar Hundert Jahre entwickelt hat. Das Bergsteigen (nicht das Sport- und Eisklettern oder das Bouldern) ist übrigens auch eine der wenigen Sportarten, in der die erbrachten Leistungen nicht in getrennten Kategorien von Frauen und Männern gemessen werden.
Die Entwicklung des Alpinismus als kulturhistorisches Phänomen weist eine Vielzahl von Aspekten auf und stellt jene, die sich dafür interessieren vor so viele Fragen, die meiner Meinung nach alle interessanter sind als die vordergründige Frage nach der Leistung und danach, wer wann als erster oder erste auf welchen Gipfel oder durch welche schwierige Route gestiegen ist. Vor diesem Hintergrund, denke ich, dass, auch wenn es um Bergsteigerinnen geht, Aspekte wie Motivationen und Einstellungen, soziale, familiäre, persönliche Herkunft und Voraussetzungen, die zeitliche und historische Einbettung ihres Handelns sowie deren Reflexionen über das Bergsteigen und sich selbst den viel interessanteren Teil des gesamten Phänomens darstellen.
Das Bergsteigen ist übrigens auch eine der wenigen Sportarten, in der die erbrachten Leistungen nicht in getrennten Kategorien von Frauen und Männern gemessen werden.
Frauen im (Männer-)Alpinismus
Da die (von Männern geschriebene) Geschichte des Alpinismus für lange Zeit als eine reine Männergeschichte dargestellt wurde, ist es zumindest legitim, nach den Frauen in dieser Geschichte zu fragen. Haben Frauen darin wirklich keine Rolle gespielt? Hat es tatsächlich kaum Bergsteigerinnen gegeben? Oder kaum solche, die es Wert gewesen wären, erwähnt zu werden? Und wenn es sie gab, welche Rolle haben sie gespielt? Wie haben sie das Bergsteigen erlebt und wie haben sie sich dazu geäußert? Die Geschichte der Frauen im Alpinismus kann (wie die der Männer) nicht getrennt von der Geschichte der Frau (und der Männer) in der Gesellschaft betrachtet werden. Beide Geschichten gehen Hand in Hand, überschneiden sich, und die eine ist Ausdruck und Begleiterscheinung der anderen. Tatsächlich blieben Frauen über Jahrhunderte vom öffentlichen Leben ausgeschlossen.

um 1900 (Foto: Archiv Ingrid Runggaldier).
Zu den meisten Berufen, zu höherer Bildung, zu den Wissenschaften und Künsten sowie zu politischen und administrativen Ämtern hatten sie kaum Zugang. Ihr Aktionsradius beschränkte sich für gewöhnlich auf den Raum des Privaten, auf den Bereich der Familie. Wenn überhaupt, wurden Frauen nicht als selbstständige Persönlichkeiten, sondern höchstens als Gattinnen, Schwestern, Töchter oder Mütter eines handelnden Mannes wahrgenommen. Erst ab den Siebzigerjahren des 20. Jahrhunderts begannen Feministinnen, der Geschichte unserer Vorfahrinnen systematisch nachzuspüren und sie sichtbar zu machen.
Seither wurden die Namen vieler bedeutender Frauenpersönlichkeiten aus der Anonymität geholt, ihre Geschichten rekonstruiert, ihr Wirken beleuchtet. Damit wurden ihre Leistungen zumindest im Nachhinein honoriert. Diese „Aufdeckungsarbeit“ erfolgte für viele Lebens- und Berufsbereiche, in Ansätzen auch im Alpinismus und sie zeigt, dass es bereits in seiner Anfangszeit viel mehr Bergsteigerinnen gab, als gemeinhin bekannt ist; aber auch, dass Frauen, obschon sie in der Alpingeschichte kaum Beachtung fanden, auf ihre Weise ebenso Alpingeschichte geschrieben haben wie die Männer – nur handelt es sich dabei um eine eigene, eben nicht von Rekorden gekennzeichnete und bestimmte Geschichte, die dennoch überaus lebendig und noch lange nicht zu Ende erzählt ist.
Biographische Spurensuche
Bei der Aufarbeitung der Geschichte des Frauenbergsteigens geht es vor allem um das Zugänglich-und-anschaulich-Machen vieler „Geschichten“ und Biographien. Sie ähnelt einer archäologischen Suche nach Relikten und der geduldigen Rekonstruktion eines Mosaiks aus zahllosen winzigen Fundstücken. Das Gesamtbild mag zwar Lücken aufweisen, aber was es darstellt, ist erkennbar. So bleiben von manchen Lebensgeschichten große Teile verborgen, während andere Aspekte wiederum wenig zur Perspektive der Frauen am Berg beitragen. Ein speziell in der Frauenforschung und somit auch in der Erforschung früherer Alpinistinnen typisches Hindernis und eine Kuriosität ist beispielsweise die Verwendung der Namen. Probleme ergeben sich insbesondere bei verheirateten Frauen.

So drohen die Identitäten von Bergsteigerinnen hinter veränderten oder unvollständigen Namen zu verschwinden, wie etwa bei Eliza Robinson, die ihr Buch (ein sehr frühes Werk über eine alpinistische Unternehmung) mit der anonymen Bezeichnung „Mrs. Cole“ – ohne ihren Vornamen und mit dem angeheirateten Namen – unterzeichnete, um ihre Identität nicht ganz preiszugeben. Gerade bei verheirateten Bergsteigerinnen kam es gelegentlich vor, dass sie in verschiedenen Phasen ihres Lebens unter verschiedenen Namen auftraten, weil sie beispielsweise bereits vor ihrer Heirat einen gewissen Bekanntheitsgrad erlangt hatten und später ihre Berichte mit dem Namen ihrer Gatten unterzeichneten.
Einen besonderen Fall stellt hierbei die Bergsteigerin Elizabeth Le Blond dar: Die geborene Elizabeth Hawkins-Whitshed tauchte auch mit dem Namen ihres ersten Mannes als Elizabeth Burnaby, dann mit dem Namen ihres zweiten und schließlich mit dem Namen ihres dritten Gatten jeweils als Elizabeth Main und als Elizabeth (Aubrey) Le Blond auf. Die Problematik der Nachnamen von Frauen ist unter anderem ein Grund, warum sich die Spuren von Frauen in der Geschichte leichter verloren haben. Bei Elizabeth Burnaby war es sogar der Fall, dass manche Alpinhistoriker sie wie verschiedene Alpinistinnen behandelten.
Massensport Bergsteigen
Das Bergsteigen wurde erst nach dem Zweiten Weltkrieg zunehmend eine für breite Massen zugängliche Sport- und Freizeitbetätigung. Dabei stellte sich nicht mehr so sehr die Frage nach dem „Ob“ sondern vor allem jene nach dem „Wie“: Wie wird und wurde ein Gipfel erklommen, über welche Route und unter welchen technischen Schwierigkeiten? Auch stellte sich weniger die Frage, ob es für Frauen angebracht war zu klettern oder nicht. Vielmehr interessierte nun, auf welchem Niveau sie es taten. Während für Bergsteigerinnen früher die wohl beachtlichste Leistung darin bestand, überhaupt aus dem den Frauen zugewiesenen Umfeld der Familie herauszutreten (und gar nicht darin, auf einen Gipfel steigen zu können), waren die Voraussetzungen nunmehr andere geworden. Auch für Frauen ging es zunehmend darum, ihr Können unter Beweis zu stellen und möglichst schwierige, anspruchsvolle Touren durchzuführen.
Auch stellte sich weniger die Frage, ob es für Frauen angebracht war zu klettern oder nicht. Vielmehr interessierte nun, auf welchem Niveau sie es taten.
Die Tat zählte, nicht mehr allein die Betätigung. Die Entwicklung des sogenannten Frauenbergsteigens bekam in Europa besonders mit der Verbreitung des Sportkletterns in den Siebzigerjahren einen beachtlichen Schub. Es ist wohl kein Zufall, dass diese Entwicklung mit der zweiten Welle der Frauenbewegung zusammenfiel und in der Folgezeit rasant vonstatten ging. Die Mitgliederzahlen von Frauen in den alpinen Vereinen wuchsen in jüngster Vergangenheit auf plus minus die Hälfte aller Eingeschriebenen an. Heute nehmen Frauen an Trekkings teil, beteiligen sich wie Männer an Kletterkursen, unternehmen Exkursionen und auch schwierige Touren.

Gipfel des Plattkofels in den Dolomiten (Foto: Museum OeAV).
Viele von ihnen klettern in selbstständigen Frauenseilschaften oder nehmen als gleichwertige Kletterpartnerinnen an gemischten Seilschaften teil. Auf einem mittleren bis höheren Niveau stehen Frauen ihren männlichen Bergsteigerkollegen zweifellos in nichts nach und überragen sie teilweise auch an Ausdauer, Geschicklichkeit, bergsteigerischem Können und Erfahrung. Was den Freizeitsport betrifft, können Frauen heute ohne Weiteres mit den Männern konkurrieren. Doch die Situation ändert sich, wenn von bergsteigerischen Spitzen- und Extremleistungen die Rede ist. So stellt sich schon die Frage, warum sich Frauen heutzutage kaum bei der Entwicklung neuer Tendenzen, als Erstbegeherinnen neuer Wege und als Rekordhalterinnen finden? Warum vermögen sie in den verschiedenen Bereichen des Bergsteigens selten wirklich neue Maßstäbe zu setzen oder neue Richtungen vorzugeben?
Anders gefragt: Warum scheinen Frauen in der Entwicklung des Bergsteigens den Männern immer hinterher zu hinken?
Spitzenbergsteigerinnen
Zwischen 1963 und 1975 kletterte Yvette Vaucher alle sechs großen Nordwände der Alpen, Catherine Destivelle und Luisa Iovane brachten mit ihren Leistungen im Sport- und Alpinklettern das Frauenbergsteigen auf das Niveau der Männer und Lynn Hill gelang 1993 mit der ersten freien Durchsteigung der Nose (ein Jahr später in 23 Stunden) das, was noch kein Mann vor ihr in dieser Wand geleistet hatte (und was erst Jahre später wiederholt werden konnte). Im Höhenbergsteigen folgten nach der ersten Frauenexpedition in den Fünfzigerjahren zahlreiche weitere auf die höchsten Berge der Welt. 1975, im internationalen Jahr der Frau, erreichten die Japanerin Junko Tabei und ein paar Tage später die Tibeterin Phan Tog den Gipfel des Mount Everest. 1978 war Wanda Rutkiewicz die erste Europäerin, die auf dem höchsten Gipfel der Welt stand, und 1995 gelangte Alison Hargreaves – 17 Jahre nach Reinhold Messner und Peter Habeler – auf das Dach der Welt ohne Sauerstoffgerät.
Es gibt auf der Welt mittlerweile kaum eine Route, die nicht auch von einer Frau erklettert wurde, kaum einen Achttausender, den Frauen nicht schon über die verschiedenen Routen erreicht hätten. Sie haben dies mit Männern geschafft – und ohne sie. Nie zuvor war das mediale Interesse so intensiv und über eine so lange Zeit auf das Frauenbergsteigen gerichtet wie im Jahr 2010, als vier Frauen – Gerlinde Kaltenbrunner, Edurne Pasaban, Oh Eun Sun und Nives Meroi – für den Rekord, als Erste alle 14 Achttausender bestiegen zu haben, in Frage kamen.
Die Bestrebung, dies zu erreichen, wurde in den Medien zu einem erbitterten Wettkampf, ja einem „Zickenkrieg“ stilisiert. Den Wettlauf sollte schließlich die Koreanerin Oh Eun Sun gewinnen, einige Tage später gefolgt von Edurne Pasaban. Die Unternehmung gelang ihnen 24 Jahre nach Reinhold Messner, der 1986 erstmals die Achttausender-Sammlung komplettieren konnte. In der Berichterstattung europäischer Medien wurde die Leistung von Oh Eun Sun nur mäßig gewürdigt. Zum Vorwurf wurden ihr vor allem „unlautere Mittel“ wie die Zuhilfenahme von Sauerstoff und einigen Hubschrauberflügen in die jeweiligen Basislager gemacht. Auch die Leistung Gerlinde Kaltenbrunners, als ihr im August 2011 mit der Besteigung des K2 (auf dessen Gipfel seit drei Jahren kein Mensch gestanden hatte) gelungen war, alle 14 Achttausender zu besteigen, wurde von manchem, auch prominenten Alpinismusexperten als nichts Neues, ja als langweilige Widerholung quittiert. All dies entsprach übrigens ganz einer vor allem in Bergsteigerkreisen gern gelebten Tradition: der Herabsetzung weiblicher Leistungen und solcher anderer Nationalitäten. So gesehen ließe sich ergänzen: Alles beim Alten.
Professionalisierung
Seit den Fünfzigerjahren haben sich die Lebensbedingungen der Menschen in Europa und darüber hinaus enorm verändert – ein Umstand, der sich auch im Bergsteigen zeigt. Die Veränderung des Freizeitverhaltens, ein geändertes Rollenverständnis und Verhältnis zwischen den Geschlechtern, die zunehmende Technisierung und Professionalisierung, die Bereitschaft zum Risiko einerseits und die Tendenz zur Absicherung der Gefahr sowie der damit verbundene Wandel der Lebenseinstellung und Lebenserwartung sind nur einige Faktoren, die sich unweigerlich auch auf so spezielle Bereiche wie das Frauenbergsteigen ausgewirkt haben. In der jüngsten Vergangenheit hat in den verschiedenen Sparten des Bergsteigens eine zunehmende Professionalisierung stattgefunden. Betraf diese Professionalisierung früher fast ausschließlich das Bergführerwesen, so hat sich diese letzthin nicht nur auf die Bergrettung, sondern auch auf das Höhenbergsteigen und die Ausübung des Hallen-, Fels- und Eiskletterns als Sportdisziplinen in Form von Wettbewerben ausgeweitet. Der Leistungssprung, der aufgrund dieser Professionalisierung und der Entwicklung der technischen Ausrüstung erfolgte, ist gigantisch. Was vor wenigen Jahrzehnten noch undenkbar erschien, etwa die Durchsteigung schwieriger und langer Wände in ungeahnter Rekordzeit, ist heute Realität.
Die Professionalisierung alpiner Tätigkeiten hat bei Frauen offensichtlich später eingesetzt als bei Männern und sich zum Teil gar nicht richtig durchgesetzt. Gewiss gab es schon früh Frauen, die sich beispielsweise als Bergführerinnen betätigt haben, wie die polnische Bergsteigerin Zofia Radwanska Pariska, die bereits 1946 die Bergführerprüfung ablegte und daraufhin eine Alpinistenschule in Zakopane gründete, oder die Britin Gwen Moffat, die 1953 vom British Mountaineering Council offiziell als Kletterführerin und Ausbildnerin anerkannt wurde. Doch wird der Beruf der Bergführerin auch heute noch so selten ausgeübt, dass sich die aktiven Bergführerinnen des gesamten Alpenraums – das sind vielleicht einige wenige Dutzend – untereinander mehr oder weniger per Namen kennen. Noch weniger Frauen sind beruflich in der Bergrettung tätig – mit Ausnahme vielleicht von Lawinenhundtrainerinnen – und sie üben ihren Dienst nach wie vor eher als ehrenamtliche Tätigkeit aus. Am frühesten, erfolgreichsten und nachhaltigsten erfolgte die Professionalisierung des Bergsteigens bei den Frauen wohl im Rahmen des Sportkletterns.
Ohne die Ausübung des Klettersports in Form einer professionellen Betätigung hätten Athletinnen wie Catherine Destivelle, Luisa Iovane, Ines Papert nicht das Niveau erlangen können, das sie als Spitzenkletterinnen auszeichnet. Auch unter den Höhenbergsteigerinnen erzielten in der Regel nur jene Frauen außerordentliche Leistungen, die den Sport auf professioneller Ebene betrieben. Als Wegbereiterin ist hier wohl Wanda Rutkiewicz zu nennen, es folgten andere wie Arlene Blum und Alison Hargreaves bis hin zu den genannten Höhenbergsteigerinnen unserer Zeit. Durch die Professionalisierung des Bergsteigens hat sich auch dessen Definition verändert. Wenn schon Hettie Dyhrenfurth, die über zwanzig Jahre lang den Frauenhöhenweltrekord innehatte, zögerte, sich „Bergsteigerin“ zu nennen, stellt sich heute die berechtigte Frage, ob sich eine Person, die fünf Tage im Jahr klettert, noch Bergsteigerin oder Bergsteiger nennen kann. Um erfolgreich zu sein, kommt es eben darauf an, mit welcher Intensität und in welchem Ausmaß die bergsteigerische Tätigkeit ausgeübt wird.
Die Natur der Frau
Die Bergsteigerin Sonia Livanos, der mit ihrem Mann Georges in den Sechziger- und Siebzigerjahren viele schwierige Klettertouren gelungen waren, meinte einmal: „Es gibt bis heute keine Frau, die man als große Bergsteigerin im wirklichen Sinne des Wortes bezeichnen könne. Es liegt nicht in der Natur der Frau, für eine Sache zu leben. Die Frau lebt für jemanden. Sie gibt sich, sie schöpft nicht und erfindet nicht. Ihre Rolle ist keineswegs zweitrangig, sie ist lediglich verschieden, ja notwendig.“ (Grupp, 2008, S. 238) Livanos beschrieb eine Situation, wie sie zu ihrer Zeit noch vielfach den Tatsachen entsprach: die Frau in ihrer Rolle als Pflegende und Aufopfernde, für die es nicht selbstverständlich war, ihre eigenen Bedürfnisse und Ziele zu verfolgen. Obwohl die Pflege und Betreuung von Kindern und Kranken (bezahlt oder unbezahlt) auch heute noch vornehmlich von Frauen geleistet wird, ist es für den Großteil der heutigen Frauen selbstverständlich, die eigenen Lebensvorstellungen und -pläne zu realisieren. Sie leben sehr wohl „für eine Sache“, eine Leidenschaft, schaffen Neues, sind kreativ, unternehmungsfreudig, mutig und leistungsfähig.
Sonia Livanos kann entgegengehalten werden, dass Frauen, wenn es auch wahr wäre, dass sie keine „großen Bergsteigerinnen“ sind, nicht aufgrund ihrer Natur keine großen Bergsteigerinnen werden konnten, sondern weil sie sich dem Bergsteigen nur in Ausnahmefällen professionell widmen konnten. Kaum zu widersprechen ist dagegen der Aussage von Wanda Rutkiewicz, die das Höhenbergsteigen wie ein Mann als Profi betrieb und der Ansicht war, dass die besten Männer besser als die besten Frauen klettern würden und Frauen deshalb mit Frauen klettern sollten. In der Tat ist nicht zu leugnen, dass Frauen hinsichtlich ihrer physischen Kraft und Ausdauer zumeist in einer anderen Kategorie als die Männer spielen. Während es aus diesem Grund in den meisten Sportarten getrennte Bewerbe für Frauen und Männer gibt, ist dies beim Alpinklettern und Höhenbergsteigen nicht der Fall. Dabei ist es nicht verwunderlich, dass Frauen im direkten Geschlechtervergleich meist als der unterlegene, schwächere Teil der Seilschaft hingestellt werden: Die altbekannten Diskriminierungen gibt es immer noch.
Dies bestätigt auch eine Ausnahmebergsteigerin wie Nives Meroi. Sie ist überzeugt, dass viele der Meinung wären, ihr Mann und Kletterpartner würde sie bei ihren Expeditionen mit aller Kraft am Seil hochziehen. Meroi rät den Frauen – nicht nur den Bergsteigerinnen –, sie selbst zu sein, fernab von jedweder Imitation männlichen Verhaltens. Zwar seien Frauen den Männern gegenüber benachteiligt, weil sie körperlich nicht so stark seien, doch würden sie dies kompensieren, weil sie mit Schwierigkeiten besser umgehen könnten. Die Tatsache, dass Frauen und Männer im Alpinismus sich nicht wie in anderen Sportarten in getrennten Bewerben messen können, ist wohl auch mit ein Grund, warum sie heute noch immer von Neuem als die „Unterlegenen“ aus dem Rennen gehen. Frauen treten den Wettbewerb immer noch unter anderen Voraussetzungen als Männer an.
Der Alpinismus steht hier stellvertretend und symbolisch für andere Lebensbereiche: Betrachten wir die Situation der Frauen hinsichtlich ihrer Präsenz in Spitzenpositionen etwa in der Politik oder Wirtschaft, so müssen wir feststellen, dass sie nicht viel anders ist als etwa im Höhenbergsteigen: Je höher sie steigen, desto rarer sind sie. Während sich bis zu einem gewissen Niveau die Anzahl von Frauen und Männern etwa die Waage hält, wächst das Missverhältnis zu Ungunsten der Frauen proportional an, je extremer, sichtbarer, finanziell interessanter, verantwortungsvoller und machtbezogener ein Tätigkeitsfeld wird. Auch im Alpinimus scheint es eine Art gläserne Decke zu geben, die Frauen davon abhält, ganz nach oben zu gelangen. Bei aller Emanzipation, trotz der gesellschaftlichen Veränderungen, die es Frauen theoretisch erlauben, das zu tun, was sie wollen, hat sich für sie letztendlich kaum wirklich etwas geändert: Frauen bleiben die großen Abwesenden, die Ausnahmen, die die Regel bestätigen.
Quotenregelungen würden besagter Situation in der Arbeitswelt und in der Politik sehr wahrscheinlich entgegenwirken. Die Einführung getrennter Bewerbe für Männer und Frauen im Alpinismus und insbesondere im Höhenbergsteigen, die einer Art Quotenregelung gleich käme, wird jedoch kaum möglich sein und wäre wohl ein quasi absurdes Ansinnen. Spätestens an dieser Stelle stellt sich die Frage, ob Frauen also doch anders bergsteigen als Männer. Haben sie andere Ziele, andere Befindlichkeiten? Klettern sie wirklich anders? Haben sie eine unterschiedliche mentale Disposition, eine geringere Risikobereitschaft, andere Motivationen und Zugangsweisen zum Bergsteigen? Liegt ihnen weniger an Leistung? Ist ihnen die Betätigung wichtiger als die Tat? Der Weg wichtiger als das Ziel?
Erklären zu wollen, dass Frauen so seien und Männer anders, erklären zu wollen, dass gesellschaftliche Gegebenheiten und Sachverhalte auf der unterschiedlichen Natur von Frauen und Männern beruhen, scheint ein allzu einfacher Ansatz zu sein. Frauen sind unterschiedlich, so wie es Männer sind. Es gibt Frauen, die „wie Männer“ denken, klettern, handeln, und Männer, die mehr „wie Frauen“ agieren. Frauen, auch Bergsteigerinnen, sind nicht immer nur sensibel, verständnisvoll, vorsichtig, bescheiden. Und nicht alle Bergsteiger sind immer nur stark, rational, ausgeglichen, systematisch usw. Wie Frauen und Männer sich in der Welt bewegen, hängt nach wie vor mehr mit den strukturellen Gegebenheiten der Gesellschaft und mit ihrer Sozialisation als mit ihrer Natur zusammen.
Bergsteigende Mütter und Väter
Allerdings spielt die Natur eine Rolle: Die Situation einer Extrembergsteigerin ändert sich mit der Mutterschaft drastisch. Tatsächlich müssen sich Bergsteigerinnen noch immer die Frage gefallen lassen, wer sich während ihrer Expeditionen um ihre Kinder kümmert. Als Alison Hargreaves auch nachdem sie Mutter zweier Kinder geworden war, weiterhin auf Expedition ging und sie ein Journalist fragte, ob es für sie nicht ein Problem sei, ihre Kinder allein zu Hause zu lassen, antwortete sie: „Sie sind nicht alleine, sie haben einen Vater.“ Als Hargreaves 1995 dann am K2 verunglückte, löste dies in der gesamten Bergsteigerwelt einen Sturm von Kritik aus.
Dass die Ehefrauen der Bergsteiger zu Hause bei den Kindern bleiben, wird als selbstverständlich erachtet.
Ganz anders stellt sich die Situation für professionell bergsteigende Väter dar. Die Öffentlichkeit macht solchen Männern ihre Abwesenheiten viel weniger zum Vorwurf, ja bringt im Gegenteil Verständnis für ihre Leidenschaft auf. Bergsteigerinnen und Bergsteiger werden nach wie vor unterschiedlich behandelt und beurteilt. Dass die Ehefrauen der Bergsteiger zu Hause bei den Kindern bleiben, wird als selbstverständlich erachtet. Extrembergsteigerinnen mit Kindern sind Rabenmütter, Extrembergsteiger mit Kindern Helden – immer noch. Auch Frauen verwirklichen sich wie Männer durch die Tat und nicht allein durch die Betätigung. Es kommt jedoch wohl auf die Art der Tat an. Die Entwicklung des Alpinismus scheint in den letzten Jahren an eine Grenze gelangt zu sein. Sie ist vielfach nur mehr in technischen Details sowie in immer neuen – und lediglich für einen kleinen Kreis von Spezialisten unterscheidbaren – Rekorden zu beobachten. Alle höchsten Berge der Welt sind erklommen, die noch verbliebenen schwierigsten Routen auf die Berge der Welt werden wohl in den nächsten Jahren abgehakt. Der Handlungsraum ist dabei lange noch nicht ausgeschöpft. Aber Neues?
Sinnhaftigkeit
Das Noch-schneller, das Noch-mehr, das Noch-direkter ist für viele Bergsteigerinnen, aber auch viele Bergsteiger, nicht mehr von Bedeutung. Sie haben Schwierigkeiten, sich damit zu identifizieren, und definieren den Alpinismus für sich neu – unter anderem vielleicht auch dadurch, dass sie der Tat vermehrt die Betätigung vorziehen? Spitzenbergsteigerinnen wie Nives Meroi oder Bärbel Hirschbichler zeigen diesbezüglich neue (alte?) Wege auf und leben neue (alte?) Modelle der Bergerfahrung vor. Meroi, deren Mann 2009 erkrankte, hat das Höhenbergsteigen seitdem aufgegeben, um ihm nahe zu stehen. Ohne ihren Partner macht das Bergsteigen für sie nach ihrem Bekunden keinen Sinn. Bei Hirschbichler ist das soziale Engagement an die Stelle der Passion für das Bergsteigen getreten oder dazugekommen. Als Gründerin des Vereins Himalaya-Karakorum-Hilfe setzt sie sich mit nachhaltigem Erfolg für die Unterstützung von Menschen ein, die am Existenzminimum leben.
Ihrem Beispiel sind mittlerweile viele andere Höhenbergsteigerinnen und -bergsteiger gefolgt, die in zahlreichen wertvollen Projekten den Menschen helfen, die in den höchsten Bergregionen der Welt in schwierigsten Verhältnissen leben. Rund um den Alpinismus haben sich alternative Wege und Modelle ergeben. Neu sind sie nicht und „typisch weiblich“ wohl auch nicht. Es handelt sich jedoch um unauffällige, unspektakuläre, wenig sichtbare Taten, die mit Umsorgung, Mitgefühl, Solidarität und sozialem Engagement zu tun haben, Betätigungsfelder, in denen Frauen traditionsgemäß stark vertreten sind. Einiges davon haben bereits die Pionierinnen des Alpinismus vorgelebt. Das Wissen über diese Frauen und die Erfahrungen der späteren Bergsteigerinnengenerationen zeigen, wo Frauen im Alpinismus heute stehen und auch früher schon standen: an ihrem eigenen Platz, den jede einzelne Bergsteigerin selbst für sich erobert hat.
Wünschenswert wäre es, wenn wir im Gegensatz zum herkömmlichen – sprich männlichen – Alpinismus, nicht mehr von Frauenalpinismus reden müssten.
Kategorie Mensch
Wünschenswert wäre es, wenn wir im Gegensatz zum herkömmlichen – sprich männlichen – Alpinismus, nicht mehr von Frauenalpinismus reden müssten. Wünschenswert wären Veranstaltungen zum Thema Alpinismus, bei denen Bergsteigerinnen nicht als exotische Begleiterscheinung an einem eigens vorgesehenen „Frauentag“ vorkommen, sondern einfach vermehrt berücksichtigt und auf gleicher Augenhöhe mit ihren männlichen Bergsteigerkollegen auftreten könnten. Wenn es schon keine getrennten alpinistischen Bewerbe gibt, so sollten Bergsteigerinnen auch sonst nicht als getrennte Kategorie behandelt werden: Das nämlich heißt, sie einerseits zu diskriminieren und sie andererseits auf ein Podest zu stellen – am einen liegt ihnen nichts, am anderen kann ihnen nicht gelegen sein.