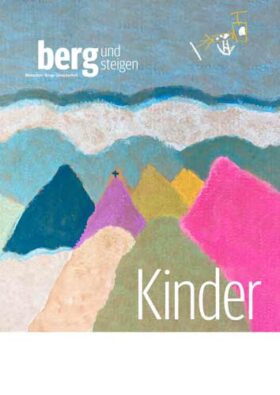Seilschaft mit dem Tod
Präambel
Die jährlichen Bergunfallstatistiken sind Zahlen, die wenige Emotionen verursachen, und theoretisch wissen wir alle, dass es uns oder unsere Bergpartnerinnen mit einem schweren oder tödlichen Unfall treffen kann. Vielleicht kommt uns beim Lesen ein „zum Glück nicht ich“ oder sogar ein „das passiert mir doch nicht“ in den Sinn. Nach genauerem Umfragen und Hinhören mussten allerdings doch viele Freunde und Kollegen genau dies erleben. Wir versuchen uns diesem Thema anzunähern, aus systemischer Sicht und als Klettertrainerin, als Bergführer. Auch mit dem Ziel, Betroffenen in dieser schwierigen Situation zu helfen.
Systemischer Exkurs
Systemisches Denken und Arbeiten bedeutet vereinfacht gesagt, alle Wechselwirkungen zwischen den beteiligten Personen und auch im inneren Erleben eines Menschen zu betrachten. Da wir aus dieser Denkschule kommen, wollen wir alle Blickwinkel beleuchten und Lösungsvorschläge anbieten. Mit dem Tod eines nahestehenden Menschen ändert sich ein System grundlegend und unwiederbringlich. Der Tod ist absolut. Für die Beteiligten muss sich ähnlich eines Mobiles, dem ein Teil fehlt, alles neu einpendeln. So kommt es zwangsläufig zu veränderten Rollen und neuen Funktionen.
Selbstbild, Weltbild, Sinnkonzepte, Lebensperspektiven und alle sozialen Kontakte unterliegen diesem Entwicklungsprozess. Durch den Tod kommt es zu maßgeblichen Veränderungen in der Welt der Hinterbliebenen und für die am Berg Beteiligten bleibt zusätzlich das traumatische Erlebnis, das es zu verarbeiten gilt. Wir wollen hier keinesfalls eine vollständige psychologische Aufarbeitung des für alle beteiligten Personen doch möglicherweise sehr traumatisierenden Ereignisses. Die Idee ist eher, das Thema der Sprachlosigkeit zu entziehen. Vielleicht entsteht daraus eine Diskussion oder ein Nachdenken über unseren Umgang mit dem plötzlichen Tod am Berg.
Der Tod in unserer Berg-Gesellschaft
Wir leben in einer Gesellschaft, in der der Tod wenig Platz hat. Dabei war das Trauern früher eine Sache der Gemeinschaft. Menschen kamen unaufgefordert in das Haus, in dem jemand gestorben war. Heute wird ein solcher Ort eher gemieden. Wenn wir Menschen begegnen, die jemanden verloren haben, betreten wir eine fremde Welt und uns fehlen die Worte. Gleichzeitig gehen wir in die Berge mit der trügerischen Gewissheit, dass es nur den anderen passiert, nicht aber uns. Wir sind ausgestattet mit dem besten Equipment und kaufen uns Sicherheit über neue Seile, Helme und Bergführer. So verlieren wir in der heutigen Spaßgesellschaft jeglichen Bezug zu dem Thema Tod und wollen ihn auch gar nicht nah an uns heranlassen. Was hat denn der Tod für eine Bedeutung? Wie geht es mir eigentlich mit meiner eigenen Sterblichkeit? Mit der Sterblichkeit von nahen Menschen, Bergpartnerinnen oder sogar Gästen?
Interviews mit Betroffenen
Um unsere Gedanken zu diesem tiefgreifenden Thema mit Leben zu füllen, haben wir Zitate aus Gesprächen mit Betroffenen eingefügt. Um Angehörige zu schonen, haben wir die Namen geändert. Es hat uns sehr berührt, mit Betroffenen zu sprechen, und wir möchten uns für den Mut und die Offenheit bei den Gesprächen bedanken. Wir haben mit Julia gesprochen, deren Bergpartnerin kurz vor dem Gipfel von einem Stein getroffen wird und vom Grat fällt.
Einen weiteren Einblick hat uns Bergführer Karl gegeben, dessen Gast auf einer Expedition am Ende der Fixseile in leichtem Gelände ausgleitet und vor seinen Augen abstürzt. Auch Bergsteiger Franz erlebt, wie der Freund am Matterhorn durch Steinschlag den Halt verliert. Es beschäftigt ihn nach 30 Jahren immer noch. Wir haben viele Zitate aus den Interviews eingefügt, wir empfinden sie als selbsterklärend.
Die Erkenntnisse und Lösungsansätze aus unseren Interviews und Gesprächen haben wir zeitlich geordnet in ein Vorher, als die Welt noch in Ordnung war, das akute Unfallereignis und den längeren Nachgang nach einem Todesereignis am Berg. Sehr wahrscheinlich könnte man diese Gedanken problemlos auf unser „normales Leben“ übertragen. Ist doch das Bergsteigen ein Spiegelbild unserer Gesellschaft.

Was können Bergsteiger*innen im Vorfeld tun, um uns besser auf einen möglichen Unfall vorzubereiten?
1. Gespräch(e) mit den Bergpartner-innen und Verantwortungsklärung
Es kann zum einen sehr hilfreich sein, sich im Gespräch darüber bewusst zu werden, welche Risiken in einer bestimmten Tour gegeben sind und wie es jedem der Partner mit dem eigenen Tod und dem der anderen geht. Oder die persönliche Auseinandersetzung. So erzählt uns Julia zum tödlichen Absturz ihrer Seilpartnerin:
„Dass ich schon so oft diesen Film im Kopf hatte, hat mir definitiv die Überraschung genommen.“
Zudem muss vorab geklärt sein, wer welche Verantwortung trägt: In dem Moment, wenn ich nicht allein, sondern mit jemandem am Berg bin, kann das im Ernstfall hilfreich sein, um die immer mitschwingende Schuldfrage nach einem Unfall zu klären. Gerade wenn man in einer Kameradschaft unterwegs ist und jemand mehr Erfahrung hat, muss geklärt sein, dass wir trotzdem gemeinsam unterwegs sind und keiner die Führungsposition innehat bzw. sie nur einnimmt, wenn es sein muss. Somit sollte in einer Seilschaft vorher überlegt werden, wer in welcher Rolle unterwegs ist? Sind wir gleichwertige Partnerinnen oder ist man klar als erfahrenerer Bergpartner bei Privattouren, als Begleiterin einer Gemeinschaftstour, als Führerin unterwegs? Julia:
„Wir haben sehr viel über den Tod gesprochen, wie es wäre, wenn uns ein Stein trifft … das hat mir wahrscheinlich sehr geholfen.“ „Ich sterbe bei etwas, was ich sehr gerne mache.“
2. Selbstklärung
Wir fragten Julia, ob ihr die Auseinandersetzung davor geholfen hat:
„Voll! Nicht nur die Gespräche, sondern auch dadurch, dass ich beim Klettern so oft das Gefühl hatte und so oft Filme gesehen habe. Jetzt wird der Film Realität und ich kenn den Film schon.“
Wie man sich mit dem Thema Tod auseinandersetzt, ist sicher sehr individuell, aber eine Form dafür zu finden, unterstützt mit Sicherheit den Prozess bei einem akuten Todesfall.
3. Gespräch mit dem Umfeld
Es scheint enorm hilfreich zu sein, wenn wir mit unserem nahen Umfeld über das Thema sprechen. Das heißt nicht, dass wir mit eklatanten Todesahnungen unser Umfeld in Angst und Schrecken versetzen wollen, sondern eher ein klares Gespräch über unser Tun führen. Dass wir in einen Risikoraum eintreten und das bei wachem Verstand tun. Dass es für uns so unglaublich bereichernd ist, sich in diesem Risikoraum zu bewegen. Dann kommt es für die zwangsläufig am Unfall Beteiligten nicht zu der äußerst unangenehmen Situation, dass die nahen Menschen völlig überrascht sind. Wir zitieren Julia und Franz:
„Mit dem nahen Umfeld darüber sprechen, dass der Tod möglich ist bei diesem Tun, aber es gleichzeitig so viel zu gewinnen gibt und dies bewusst in Kauf genommen wird. Wenn dann das Risiko ernst macht, dann ist es für die anderen leichter …“
„Hattest du dir im Vorfeld zu dem Thema Gedanken gemacht? Ja, seit dem Absturz des Gefährten vor langer Zeit.“
4. Bergsteiger-Community
Gespräche in der Community können absolut hilfreich sein, uns wieder bewusst zu werden, dass wir den Gefahrenraum mit unserem Tun betreten. Denn Julia hat es erlebt:
„Die Message ist: Es passiert wirklich, und viel öfter, als wir meinen.“
Das heißt nicht, dass wir uns auf jeder Tour ausführlich mit dem Tod beschäftigen müssen, aber ein Gespräch unter Bergpartner*innen kann unser inneres System im Vorfeld stärken und wappnen. Zudem kann ein offenes Ohr helfen, das Thema Tod am Berg sichtbarer zu machen. Oft wird dies aus Verdrängungsgründen nur kurz gestreift. Wer will schon alte Wunden aufreißen.
Es ist natürlich einfacher über das Schöne am Bergsport zu philosophieren oder das Bergsteiger-Latein zu strapazieren. Bei Gelegenheit könnten wir den Faden aufnehmen und nachfragen, wie die anderen mit dem Thema z. B. im jeweiligen Umfeld umgehen. Vielleicht gelingt es ab und an.

Wenn es passiert ist und die Stunden und Tage danach
Das Ereignis
Die ersten Gedanken sind (wir zitieren Franz’ Gedankenbruchstücke): „Erst glaubst, das ist ein Rucksack, das Rote, das da fällt, dann doch der Freund, er wird wohl weiter unten liegen, es wird schon nicht so schlimm sein.“
Bergführer Karl beschreibt: „Da war Fassungslosigkeit. Unglaube, wo fällt der hin? Er bleibt dann weiter unten liegen, der muss noch leben …“
Julia: „Aber sie bleibt ja gleich liegen. Und dann blieb sie nicht liegen. Sie ist um die Ecke gefallen. Ich hab geschrien, ihren Namen geschrien. Ich hab nicht so viel gedacht. Gerade war ich noch zu zweit, jetzt bin ich allein. Ich sitz in einer Kulisse, die gerade noch die geilste ever war – da will man sein, und dann macht es so, du bist in der gleichen Kulisse und auf einmal ist alles anders.“
Dann setzt die Gewissheit langsam ein, eventuell durch eine Bestätigung. Franz beschreibt das 30 Jahre nach dem tödlichen Unfall so:
„Nach dem Ausfliegen sagte der Flugretter auf Nachfrage, was mit dem Freund sei: ‚Der ist total zerschlagen!‘ “ Weiter erzählt Franz: „Da war eine gewisse Unfassbarkeit, da war der Versuch, Erklärungen zu finden, da war Leere. Aber trotz oder wegen der derben Wortwahl: Es war dann auch ganz klar, der ist tot! Das war irgendwie auch hilfreich.“
Auch Julia erzählt: „Als der Helikopter sofort 500 m tiefer geflogen ist, war es mir klar, so etwas überlebt man nicht, jetzt ist das passiert, womit ich mich schon so viel auseinandergesetzt habe.“ Weiter: „Diese Rettungsleute und alle, die sich um mich gekümmert haben, waren so perfekt! Er hat ganz klar gesagt, was ist. Der Notarzt hat mich vorgewarnt:
‚Sie ist tot.‘ Offenheit, die ich total geschätzt habe. Offenheit, was ist und wie es weitergeht und was es für Optionen gibt.“
Was braucht es für uns Beteiligte im akuten Schock für Fähigkeiten? Hier hilft das Szenarientraining, das in guten Erste-Hilfe-Kursen geübt wird: Selbst- und Gruppenschutz, Notruf absetzen, eigentlich nur für das eigene Überleben oder das der Gruppe zu sorgen. Was auch als hilfreich beschrieben wurde: sich im Vorfeld dem Thema widmen. Keine voreiligen Entscheidungen treffen, Psychohygiene betreiben, vor allem keine Schuldzuweisungen gegen sich selbst und anderen.
Die Schuldfrage
Trotz vielleicht guter Reflektion im Vorfeld macht es einen erheblichen Unterschied, wenn es einen selbst trifft. Speziell die Frage nach der Verantwortung stellt sich schnell.
Führer Karl: „Hätte ich es verhindern können? Meine Rolle als Bergführer …“
Kletterpartnerin Julia: „Die mich geborgen haben, gaben mir keine Schuld“, „Wir hatten keine Schuld“, „Eine Schuldzuweisung würde so viel kaputt machen“.
Hier ist ganz wichtig zu betonen, dass jeder Mensch anders damit umgeht. Kurz nach dem Ereignis kann es hilfreich sein, sich zu fragen, was man gerade brauchen könnte, was die nagenden Gedanken ändern könnte. Und wenn man merkt, dass man aus der Schuldfrage alleine nicht rauskommt, ist es sehr wichtig, sich Unterstützung von außen zu holen. Oft sagt der Verstand‚ man ist nicht schuld, das Gefühl ist aber ein komplett anderes und man zermartert sich innerlich. Viele Betroffene verbleiben viel zu lange in der Schuldfrage und führen oft lange Zeit
ein Leben mit ‚angezogener Handbremse‘, nicht mehr fähig, sich aus ganzem Herzen zu freuen oder mit Freude wieder in die Berge zu gehen. Das nützt niemandem und kann leider das Geschehene auch nicht rückgängig machen.
Erstreaktion
Aus der Forschung ist bekannt, dass folgende drei Grundreaktionen aus unserem entwicklungsgeschichtlich alten Stammhirn sehr schnell kommen: kämpfen, totstellen oder fliehen. Die Traumaforschung (Peter A. Levine: Traumaheilung) hat herausgefunden, dass jede Form von Handeln hilfreicher sein kann als das archaische Überlebensmuster „sich totzustellen”.
Das spiegelt sich auch im Zitat von Julia: „Mir war klar, jetzt funktioniere ich noch gut.“ Wenn wir handeln, sind wir arbeitsfähig und können das akut Notwendige tun. Aktion schafft Unterschiede zum Schock und erlaubt uns Selbstkontrolle. Bewegung hilft, dass sich psychisch traumatische Informationen im Körper weniger festsetzen.
Das Umfeld
Vor Ort: Wenn man selbst einigermaßen handlungsfähig ist (siehe oben „Handeln“): Was brauchen andere direkt Beteiligte und Unbeteiligte vor Ort? Bei dem offensichtlichen Todesfall? Bergführer Karl: „In der Gruppe wurde viel darüber geredet. Das wurde von mir auch proaktiv gesteuert. Das hat uns allen gut getan.“
Dann zu Hause: Wie kann man sich mit der Familie und den Freunden des Verunglückten gegenseitig stützen und unterstützen? Zusammenhalt mit uns nahen Menschen, oft der Familie, wird als enorm stützend erfahren, sofern das Umfeld in positivem Sinne damit umgehen kann.
Im Nachgang und nach langer Zeit
1. Verarbeiten/Aufarbeiten
Aufarbeitung ist individuell, hier gibt es keinen richtigen oder falschen Weg. Es scheint, dass Reden mit Bezugspersonen und zum richtigen Zeitpunkt, auch etwas Tapetenwechsel im positiven Sinn hilfreich sein kann. Franz erinnert sich:
„Ich habe mit einem der Beteiligten (ein guter Freund) geredet, mit den damaligen Bergfreunden und Kameraden geredet. Ich habe Abstand vom Berg gehalten, es war eine ruhige Zeit …“
Julia: „Es gab Freunde, die haben immer wieder nachgefragt.“
Franz: „Ein Urlaub am Atlantik mit einem der beteiligten Freunde, wir hatten dieselbe Verbindung zu dem Unfall und es wurde immer wieder mal darüber gesprochen, was für uns Erleichterung brachte.“ „Man braucht jemand, mit dem man wegen des Unfalls in Verbindung ist. Und man braucht jemand Professionellen.“
Julia: „Nach Wochen der (bewusst durchlebten) Lethargie wollte ich etwas Positives erleben, etwas, das nicht mit Bergsteigen zu tun hatte, danach war es auch gut.“ „Mein Kopf ist nicht besser geworden, ich habe keine Lust mehr auf Risiko.“
2. Unterstützung
Hilfe kann professionell erfolgen oder im privaten Raum. Das Wissen, dass man nicht allein ist, kann sehr entlastend sein. Ein Familien- und Freundesnetzwerk kann enorm helfen, entweder um darüber zu sprechen oder auch um gezielt nicht davon zu reden, sondern sich abzulenken. Private Unterstützer*innen sollten allerdings gut auf sich achten, damit sie nicht selbst in die Überforderung kommen. Das kann herausfordernd sein. Dann hilft auf jeden Fall professionelle Unterstützung. Franz im Rückblick zu der Frage, was er gebraucht hätte:
„Begleitung psychologischer Natur ist unbedingt wichtig.“ „Ein von außen kommendes professionelles Gespräch oder Gesprächsangebot zur Unterstützung.“
Karl empfand als enorm wertvoll: „Beim Heimkommen die Unterstützung meiner Frau, die Wärme von daheim, sich fallen lassen können, jedes Gespräch in Richtung Entlastung (Verantwortung/Schuld).“
3. Trauer
Es gibt nicht das „richtige“ oder „falsche“ Trauern. Es gibt viele Wege zu trauern und es ist völlig individuell. Alle Gefühle und Gedanken sind erlaubt und dürfen da sein. In Anlehnung an die Sterbeforscherin Kübler Ross mit ihren fünf Phasen der Trauer von Sterbenden
– Verdrängung, Wut, Verhandlung, Verzweiflung, Akzeptanz –
erlauben wir uns, diese Emotionen auch Beteiligten zuzugestehen. Wichtig dazu ist, dass Trauer nicht überwunden werden muss, sondern zum Leben gehört. Was gibt es Endgültigeres als den Tod und die damit verbundene Trauer? Wie lange sollte man trauern? Zeit heilt bekanntlich Wunden, aber niemand weiß, wie lange Zeit ist. Tiefsitzende Erlebnisse sind prägend und unvergesslich. Das darf so sein und kann uns eventuell sogar zu einer bewusst umsichtigeren Bergsteigerin machen. Unsere Interviewbruchstücke dazu:
„Belastend war, wie von außen erwartet wurde, wie man zu trauern hat“, „Der Verlust ist natürlich hart“, „Ich freue mich über die Erinnerungen, will das Schöne nicht vergessen“,
„Wenn wieder etwas passiert, wie die Kollegen, die in letzter Zeit gestorben sind, da kommen die Bilder schnell wieder“, „Aber es geht mir schon gut, nur das Herzblut für Expeditionen ist weg und die Gefahr bewusster im Hier und Jetzt“.
4. Positiver Ausblick
Es gibt eine positive Veränderung des direkten Helfersystems. Die mentale/psychologische Unterstützung in so einem Krisenfall wurde auf ein hohes professionelles Niveau gehoben. Vor 30 Jahren sah das noch anders aus, Zitat Franz:
„Da gab es gar nichts, weder von der Rettung noch von den Behörden, wir sind halt heimgefahren.“ Inzwischen klingt das jetzt ganz anders: „Die waren so unfassbar gut, die haben mich gelassen, die haben mir vertraut, die haben ganz klar gesagt, was Sache ist“.
Im fernen Ausland kann es möglicherweise schwieriger sein. Aber im Alpenraum und zu Hause gibt es, außer z. B. dem Krisenmanagement der Alpenvereine oder der Bergführerverbände mit entsprechenden Hotlines, auch sonst eine große Bereitschaft zu unterstützen. Franz: „Die Unterstützung des Reiseveranstalters war hervorragend, vom Verband wurde ich top unterstützt, auch vom Rechtsanwalt sehr gut bei dem im Nachgang eintrudelnden Schreiben der Staatsanwaltschaft.“ Der Wunsch nach einer Art professioneller bergpsychologischer Unterstützungsstelle wurde geäußert: „Gut wäre eine richtige Anlaufstelle, die etwas mit dem Thema zu tun hat, der man nicht erklären muss, warum man das Seil weggetan hat.“
Fazit
- Unbedingt professionelle Unterstützung suchen und annehmen.
- Alle Ressourcen im persönlichen und beruflichen Umfeld nützen.
- Im Vorfeld für sich selbst mit dem nahen Umfeld Klarheit schaffen und die Freunde/ Begleiter/Geführten dazu ermutigen, das Thema zu Hause anzusprechen und so gut wie möglich vorab zu klären.
- Die Schuldfrage ist sehr essenziell für die Beteiligten. Implizite Zuweisungen können sehr viel Schaden anrichten.
- Der Tod eines Bergpartners bleibt ein Teil von uns, auch wenn er gut verarbeitet werden konnte.
- Darüber sprechen, sprechen, sprechen, wenn Zeitpunkt und Gesprächspartner*in passend sind.
Abschlusszitat von Julia:
„Augen auf! Ich glaube, jedem echten Alpinisten ist klar, dass es passieren kann. Und wenn dir das nicht klar ist, bist du kein echter Alpinist.“
Exkurs: Trauma und Trauer
Der Trauma-Forscher Bessel van der Kolk (1994) geht davon aus, dass Sinneserfahrungen in der extremen traumatischen Erregung fragmentiert gespeichert und vom Gehirn nicht angemessen interpretiert werden können. Man ist „sprachlos vor Schreck“, „der Schock sitzt in allen Gliedern“. Eine solche „Notfall-Schaltung“ des Gehirns ist zwar in der lebensbedrohlichen Situation äußerst effektiv, da sie die gesamte zur Verfügung stehende Energie des bedrohten Menschen auf die basalen Überlebensreaktionen (Selbstbefreiung, Gegenwehr oder Erstarrung) konzentriert. Sie führt jedoch dazu, dass die Sinneseindrücke dissoziiert, also abgespaltet, gespeichert werden, über lange Zeit in Verbindung mit somatischen, also körperlichen Empfindungen und affektiven Zuständen präsent bleiben und noch Jahre später mit einer solchen Lebhaftigkeit wiederkehren können, als ob die betreffende Person die Erfahrung wieder von Neuem durchlebt (Hüther et al 2010). Das Trauma ist nicht „vergangenheitsfähig“ (Lamprecht 2000).
Betroffene Menschen leiden in ihrem Beziehungsgeflecht, ihre Angehörigen und Freunde sind erhöhtem Stress ausgesetzt. Schon in den ersten Tagen und Wochen nach einem Trauma ist es für die Betroffenen von entscheidender Bedeutung, wie stabil das Unterstützungssystem auf die neuen, manchmal für andere erschreckenden Verhaltensweisen reagiert. Das familiäre und soziale Umfeld stellt die wichtigste Ressource für traumatisierte Individuen dar (Maercker 2008).