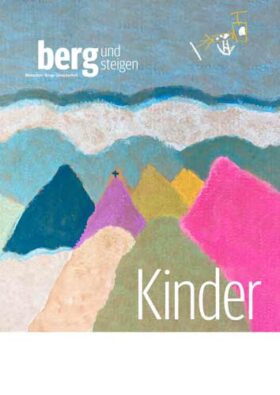Kurzschluss 2.0: „Gehen am kurzen Seil“ in der Südtiroler Bergführerausbildung
Als Allererstes gilt es, den Begriff „Gehen am kurzen Seil“ zu definieren. Handelt es sich dabei um die klassische verkürzte Seilschaft beim Begehen eines Gletschers, wobei die Hauptgefahr der Spaltensturz ist, oder um gemeinsames Gehen in kurzen Abständen im einfachen Gelände zum Seiltransport, wobei keine Absturzgefahr besteht?
Nein, beim Bergführen handelt es sich definitiv um etwas anderes, und zwar um eine Sicherungstechnik, welche den Absturz einzelner Mitglieder der Seilschaft verhindern soll! Dementsprechend gehört diese Methode seit eh und je zu den wichtigsten Inhalten der Ausbildung zum Berg- und Skiführer in Südtirol. Dies auch deshalb, weil das „Gehen am kurzen Seil“ vom Bergführer als Sicherungsmethode angewandt wird, was ihn vor allem im Fels von einer selbständig agierenden Seilschaft klar unterscheidet.
Teilnehmer, die die Zugangstests zur Bergführerausbildung bei uns in Südtirol bestanden haben, sind in der Regel gestandene Alpinisten in den Disziplinen Skitouren, alpines Felsklettern und Hochtouren, haben aber meist wenig Ahnung vom Gehen am kurzen Seil. Die Sicherungstechnik „Gehen am kurzen Seil“ wird dementsprechend in den verschiedenen Ausbildungsmodulen von der Pike auf gelernt. Der nötige zeitliche Raum dafür wird bereits bei der Erstellung des Ausbildungsplanes geschaffen.
Es wird viel Wert auf eine progressive Herangehensweise gelegt, um die Thematik vollinhaltlich zu lehren. So wird bereits beim Vorbereitungskurs Fels, welcher zwar im Gelände abgehalten wird, aber größtenteils aus „Trockenübungen“ besteht, die Thematik „kurzes Seil“ in den Vordergrund gerückt. Dementsprechend viel Aufmerksamkeit und Energie wurde seit Beginn der Ausbildung in Südtirol in die Weiterentwicklung dieser Technik gelegt.

So entstand bereits im Jahre 2008 unter der Federführung von Maurizio Lutzenberger, Adam Holzknecht und Diego Zanesco eine ausführliche Ausbildungsunterlage. In dieser wurden die bis dahin gesammelten Erkenntnisse zu Papier gebracht und vor allem die Geländeschwierigkeit über verschiedene Farben definiert, um besser vermittelbare Kategorien für die Ausbildung zu schaffen. Dass der oder die Führende (Bergführer:in) beim Gehen am kurzen Seil den zu erwartenden Schwierigkeiten mit einem hohen Maß an Reserven gewachsen sein muss, versteht sich von selbst.
„Das Gehen am kurzen Seil ist die Königsdisziplin beim Bergführen. Dementsprechend wird es in allen Ausbildungsmodulen konsequent gelehrt.“
Gerade im Fels ist es an der Tagesordnung, dass der Vorsteiger kurze Kletterpassagen im III. Schwierigkeitsgrad und mehr absolut ungesichert bewältigen muss, während die Nachsteiger durch das Vorhandensein von natürlichen Sicherungspunkten optimal gesichert werden. Deshalb ist es von großer Wichtigkeit, dass sich der Bergführer sicher und souverän in diesem Gelände bewegt. Das Gehen am kurzen Seil ist eine komplexe Angelegenheit und erfordert viel Übung und Erfahrung. Essentiell ist es, innerhalb dieser Sicherungstechnik die der Situation und dem Gelände angepasste Technik anzuwenden.
Dabei muss die Technik entsprechend den Verhältnissen, der Anzahl der Gäste, dem Gewichtsverhältnis Bergführer-Kunde situationsbedingt immer wieder neu angepasst werden. Es muss abgewogen werden, welche Methode an dieser Stelle zur Anwendung kommt, um für sich selbst und den Geführten die optimale Sicherheit im Verhältnis zum Zeitaufwand zu gewährleisten. Der psychologische Aspekt beim Gehen am kurzen Seil darf auch nicht außer Acht gelassen werden.
Viele Menschen bewegen sich deutlich selbstverständlicher und damit auch sicherer im Absturzgelände, wenn sie in ein Seil eingebunden sind. Dies allein darf natürlich nicht als Sicherungstechnik anerkannt werden, fließt aber als risikoreduzierender Faktor in das große Ganze mit ein. Der Bergführer „spürt“ den Geführten über das mit der Haltehand leicht gespannte Seil und ist somit permanent über dessen physische und psychische Gefühlslage informiert.
Dolomiten
Neben den klassischen Hochtouren im gesamten Alpenraum sind es vor allem die Normalwege in den Dolomiten, bei denen das kurze Seil als Sicherungstechnik zur Anwendung kommt. In diesem permanent wechselnden Gelände bietet die richtige Anwendung des kurzen Seiles immer noch den besten Kompromiss zwischen Sicherheit und Geschwindigkeit, um Kunden sicher und effizient auf den Gipfel und auch wieder hinunter führen zu können.
Außerdem kann der Bergführer positiv auf den Kunden einwirken, indem er das Gelände optimal ausnutzt und evtl. unangenehme Stellen umgeht, welche ein Geführter in der Regel gar nicht als solche erkennen würde. Allein das Steigen knapp hintereinander und eine einfache Kommunikation sind sehr förderlich für ein reibungsloses Funktionieren der Seilschaft. Es gibt noch einen Aspekt, der für die Anwendung des kurzen Seils auf Routen mit dem Charakter der Normalwege in den Dolomiten spricht.
Immer öfter beobachtet man bei selbständig agierenden Seilschaften, dass auch im gestuften Schrofengelände Seillängen von Standplatz zu Standplatz von beträchtlicher Länge gemacht werden. Die auf Absätzen und Bänder lose liegenden Steine werden dabei unweigerlich durch das Nachziehen des Seiles gelöst und stellen oftmals eine erhebliche Gefahr für nachkommende Seilschaften dar. Dieses Risiko kann durch die korrekte Anwendung des kurzen Seiles fast zur Gänze eliminiert werden.
Entwicklung
In der oben erwähnten Ausbildungsunterlage von Maurizio Lutzenberger, Adam Holzknecht und Diego Zanesco von 2009 zum Gehen am kurzen Seil wurden vier Farben verwendet. Dabei wird die Einstufung des Geländes und der daraus resultierenden Schwierigkeiten und Techniken in die Farben Grün, Gelb, Orange und Rot unterteilt. Die Farben sollen primär für ein besseres Verständnis bei der Vermittlung der Lehrinhalte in der Ausbildung dienen.
In den vergangenen Jahren wurden mehrere praxisnahe Halteversuche im Gelände durchgeführt. Letzthin vorwiegend im Fels. Wir wissen schon länger, dass die Belastung, welche beim gleichzeitigen Gehen nur über die Armkraft gehalten werden kann, nicht besonders groß ist (max. 50 kg). Trotzdem kommt man zur Erkenntnis, dass bei guter Reaktionsfähigkeit des Bergführers und einem Gelände, das noch geneigt ist, nur über die reine Muskelkraft Beachtliches gehalten wird.
Absolute Voraussetzung dafür: Das Seil zum Geführten muss leicht gespannt sein, damit bei einem Sturz sofort reagiert werden kann, noch bevor wirkliche Fallenergie entsteht. Die einfache Lehre daraus: Wenn die Umstände es verlangen (steileres Gelände, mehrere Geführte, Gewichtsunterschied, Sturz in senkrechten Passagen möglich), muss auch beim Gehen am kurzen Seil über Fixpunkte gesichert werden.
Schlussendlich ist es der Bergführer, der permanent entscheiden muss, welche Technik er für die gegebene Situation anwendet.
Auszug aus den Ausbildungsunterlagen
Innerhalb der Sicherungstechniken beim Gehen am kurzen Seil werden unterschiedliche Vorgangsweisen angewandt. Bewusst verzichtet wird auf eine Angabe der Länge des Seiles zwischen Führer und Gast, da dies weniger von der Stufe (Farbe) abhängig ist, sondern vielmehr vom Gelände. Zudem muss die Länge des zur Verfügung stehenden Seiles im Fels sowieso permanent nachjustiert werden.
Als Empfehlung für die Gesamtlänge des Kletterseiles gelten bei uns nach wie vor mindestens 50 Meter bei Einfachseilen für klassische Normalwege. Bei der Verwendung des doppelt genommenen Halbseiles ist auch die 60-Meter-Länge oft angenehm. Die gesamte Länge des Seiles wird beim Gehen am kurzen Seil im Aufstieg natürlich so gut wie nie benötigt. Für die Abseilstellen im Abstieg ist dann die volle Länge des Seiles oftmals zwingend nötig. Ausschlaggebend für die Anwendung sind folgende Faktoren:
- Art der Route
- Steilheit und Exponiertheit des Geländes
- Felsstruktur und Sicherungsmöglichkeiten
- Anzahl der Geführten
- Gewichtsunterschied
- Routenverlauf (senkrechte Linienführung, Quergänge usw.)
- technische Fähigkeiten von Kunden und Führer
- Umwelteinflüsse (Reibung, Nässe, Gesteinsqualität etc.)

Einbinden und Seil aufnehmen – im Fels
Wird das kurze Seil (Einfachseil) im reinen Fels eingesetzt, gibt es einige kleine Unterschiede zur Anwendung am Gletscher. So bindet sich der Bergführer im Fels prinzipiell direkt mit Anseilknoten, genau wie beim Seillängenklettern, in das Seil ein und nimmt den größten Teil des Seiles über den Körper auf. Am Gletscher bzw. auf Hochtour wird das Restseil häufig im Seilsack im Rucksack verstaut und so mitgetragen. Aufgenommen wird das Seil im Fels relativ straff, damit es beim Klettern nicht stört und damit sich nicht einzelne Seilschlingen am Fels einhängen können.
Die Bewegungsfreiheit beim Klettern sollte jedoch nicht eingeschränkt sein. Das Seil wird so über die Schultern aufgenommen, dass das Zugseil von oben kommend unter der Schulter heraus in Richtung Anseilpunkt läuft. Am Anseilpunkt des Klettergurtes fixiert wird das Seil nun mit einem Mastwurf in einem HMS-Schraubkarabiner mit Drahtbügel (Positionierungssicherung). Twistlock-Karabiner mit Drahtbügel oder Safelock-Karabiner eignen sich hierfür am besten. Der einfache Schrauber wird auch akzeptiert, da es damit möglich ist, den Mastwurf mit nur einer Hand zu lösen und auch zu legen.
Wichtig ist, dass sich der Karabiner nicht drehen kann und dementsprechend bei einer möglichen Belastung immer in Hauptachsenrichtung belastet wird. Diese Methode wird bei uns seit Jahrzehnten hinterfragt und diskutiert. Die Erfahrung zeigt aber immer wieder, dass die Sicherheit beim Gehen am kurzen Seil im Fels vor allem aus der richtigen Länge des Seiles zwischen Bergführer und Gast resultiert. Diese muss permanent angepasst werden. Um dies auch zu machen, benötigt es ein einfach und schnell bedienbares Instrument.
Nach wie vor eignet sich der Mastwurf im Verschlusskarabiner mit Verdrehsicherung dafür am besten, gleich ob Twistlock, Schrauber oder Safelock. Der Gast am Seilende wird immer, gleich wie beim Seilschaftsklettern, direkt mittels Anseilknoten eingebunden. Kommt ein weiterer Gast hinzu, so wird dieser entweder mit einem Safelock-Karabiner und Sackstich im Seil oder direkt mit gestecktem Sackstich kurz vor dem ersten Gast am Seilende eingebunden.
Je geringer der Abstand zwischen den zwei Geführten ist, desto sicherer ist man unterwegs. Die Empfehlung dazu sind 1,8 bis 2 Meter. Für die Gäste ist das nicht immer angenehm, es minimiert aber das Risiko, zu viel Schlappseil zu erzeugen. Im Fels wird bewusst auf die Weiche verzichtet, eben auch um die Schlappseilbildung möglichst gering zu halten. Auch mobile Seilklemmen, wie Shunt usw., zum Einbinden in der Seilmitte werden nicht mehr verwendet.
Die Erfahrungen damit in der realen Anwendung haben gezeigt, dass ihr Einsatz unter Umständen zu einem beachtlichen Sicherheitsverlust führen kann, vor allem für den Geführten, welcher am Seilende eingebunden ist. Das Knapp-hintereinander-Einbinden der Gäste beim Gehen am kurzen Seil im Fels erhöht definitiv die Sicherheit für die gesamte Seilschaft. Im Gelände, wo Bergführer und Gäste sich noch gleichzeitig fortbewegen können, funktioniert diese Vorgangsweise hervorragend. Wird das Gelände allerdings schwieriger – gestaffeltes Klettern, oder kurze Seillängen – dann kann es für die Nachsteiger hin und wieder etwas unangenehm sein.
Durch das Fix-eingebunden-Sein ist die Bewegungsfreiheit des Mittelmannes doch stark eingeschränkt, was zwar kein erhöhtes Risiko bedeutet, den Spaßfaktor und die Qualität des Höhersteigens allerdings deutlich einschränkt. Dem kann unter Umständen durch ein doppelt genommenes Halbseil entgegengewirkt werden.
Gehen am kurzen Seil mit Halbseil
Hier muss etwas ausgeholt werden. Wie in den wahrscheinlich meisten Bergführerausbildungen im Alpenraum ist auch bei uns die Schnittfestigkeit der Kletterseile jene Diskussion, die zurzeit mit am häufigsten geführt wird. Die Erkenntnisse dazu, welche in den letzten Jahren an die Oberfläche gekommen sind, beschäftigen auch uns sehr und fließen laufend in die Führungs- und Sicherungstechnik unserer Ausbildung ein. Natürlich haben auch wir festgestellt, wie angenehm leicht und dünn die dreifach zertifizierten Seile geworden sind.
Trotz alledem sind wir bei unserer Lehrmeinung geblieben, in klassischen Felstouren als Dreierseilschaft weiterhin mit Halbseilen unterwegs zu sein. Vorausgeschickt: Die Empfehlung bzw. Lehrmeinung ist, keine Halbseile zum Bergführen zu verwenden, welche weniger als 7,9 mm Durchmesser haben. Geschuldet ist das Ganze der Realität unserer täglichen Arbeit. Beim Nachsichern von zwei gleichzeitig kletternden Gästen mittels Platte (Alpin-Tuber – immer noch das empfohlene und am häufigsten verwendete Sicherungsgerät) durch eine 500 m lange Dolomitentour macht es am Ende des Tages einen beträchtlichen Unterschied, ob mit zwei Halbseilen oder mit zwei dreifach zertifizierten Seilen gesichert wird.
Auch wenn auf dem Papier nur wenige Millimeter Unterschied festzustellen sind, so ist der gefühlte Unterschied ungleich größer zu bewerten. Ein weiteres Argument aus technischer Sicht: Aufwändige Tests, welche von unterschiedlichen Institutionen, aber vor allem von Seilherstellern zu dieser Problematik gemacht wurden, haben klar gezeigt, dass der Seildurchmesser nur eine untergeordnete Rolle in Bezug auf die Schnittfestigkeit spielt. Es ist bekanntlich das Gewicht, mit dem das Seil belastet wird, das den Unterschied macht.
Nachdem bei der klassischen Dreierseilschaft nur ein Gast an jeweils einem Seilende hängt, befindet man sich noch klar im Bereich der Norm. Meist muss auch im Abstieg nach den Klettertouren noch gesichert werden. Häufig kommt wiederum das kurze Seil als vernünftige Sicherungstechnik zum Tragen. Wenn nun zwei Halbseile zur Verfügung stehen, gehen wir folgendermaßen vor: Eines der beiden Seile wird im Rucksack verstaut und kommt nicht mehr zum Einsatz. In das verbleibende bindet sich der Bergführer in der Seilmitte entweder mit Bulinknoten oder mit gestecktem Sackstich ein.
Am besten ist es, sich gleich etwa einen Meter versetzt zur Seilmitte einzubinden, so haben die Seilenden gleich eine Distanz von etwa zwei Metern, was dem idealen Abstand der Geführten beim Gehen am kurzen Seil entspricht. Für beide Gäste steht jetzt ein freies Seilende zur Verfügung, in das sie eingebunden werden. Der Bergführer nimmt nun das Halbseil doppelt über die Schultern auf, bis der gewünschte Abstand zwischen ihm und den Geführten erreicht ist. Abbinden mit Verschlusskarabiner und Mastwurf wird genauso gemacht wie mit dem Einfachseil, nur mit gedoppeltem Halbseil.

Wichtig noch: Beim gleichzeitigen Gehen/Klettern werden die beiden Einzelstränge knapp vor dem Gast, der sich als Erster hinter dem Bergführer befindet, mit einem Sackstich verbunden. Somit kann das gedoppelte Halbseil gehandhabt werden wie ein Einzelstrang, was für sicheres Halten zwingend notwendig ist. Wird allerdings gestaffelt geklettert und über Fixpunkte gesichert, so wird der Knoten vor dem ersten Nachsteiger gelöst und beide Gäste haben einen Einzelstrang zur Verfügung, über welchen sie unabhängig voneinander gesichert werden.
Diese Methode des gedoppelten Halbseiles ist nicht nur als Kompromiss für den Abstieg zu sehen, sondern zeigt ihre Vorteile besonders auf klassischen Dolomiten-Normalwegen, wo sich Gehpassagen abwechseln mit Steilstufen, welche ansprechende Kletterei bieten. Durch das doppelt genommene Halbseil ist der Bergführer im Vorstieg immer der Norm entsprechend angeseilt.
Beim gleichzeitigen Steigen ist die Seilhandhabung durch die Verbindung der beiden Stränge mit dem Sackstich praktisch identisch mit der beim Einfachseil. Beim etwas schwierigeren Klettern, wo die Nachsteiger unabhängig voneinander über den Einzelstrang gesichert werden, erhöht sich nicht nur die Sicherheit, sondern vor allem die Qualität des Geführt-Werdens. Gäste von heute wollen nicht nur irgendwie auf den Gipfel und wieder nach unten gebracht werden, sondern möchten die schönen Kletterstellen auch genießen.
zum Teil 1: Gehen am kurzen Seil in der Schweizer Bergführerausbildung
Kooperation
Seit Herbst 2022 sind die Bergführerverbände der Schweiz, von Österreich, Deutschland und Südtirol als Redaktionsbeiräte bei bergundsteigen mit an Bord. Daher erscheint seither in jeder Ausgabe ein Beitrag dieser Verbände. Die Serie soll informieren und zugleich zu einem konstruktiven Austausch zwischen den Verbänden anregen und dadurch auch indirekt die Bergführerausbildung weiterentwickeln.
weitere Artikel zum Thema:
- Gehen am Kurzen Seil – historischer Text
- Gehen am kurzen Seil ist heikel. Die Alternativen auch.
- Gedanken zum gehen am kurzen Seil: „Es wird schon nicht gerade jetzt passieren…“