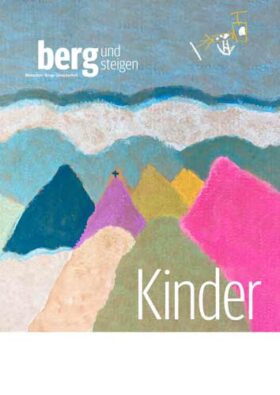Gewichtsausgleich beim Klettern: 5 Bremsassistenten im Praxistest
Einleitung
Beim Klettern ist die Sicherheit der Seilpartner eng mit der Kontrolle des Sturzzugs und der Handhabung des Bremsseils verbunden, insbesondere bei erheblichen Gewichtsunterschieden.
Ein großer Teil der Sturzenergie wird vom Seil aufgenommen. Der auf die kletternde Person wirkende Fangstoß überträgt sich – abzüglich etwaiger Reibungseffekte – als Sturzzug auf die sichernde Person. Ist ihre Gewichtskraft geringer als der wirkende Sturzzug, wird sie hochgerissen. Frühere Untersuchungen haben gezeigt, dass beim Sichern in einem reibungsarmen Umfeld, etwa bei einem geraden Seilverlauf in der Halle, der optimale Gewichtsunterschied in einer Seilschaft bei +/-5 Kilo liegt.
- Zum ganzen Artikel als PDF.
- Zum DAV Artikel: Sichern mit Gewichtsunterschied
Ist der Kletterer deutlich schwerer, besteht für die sichernde Person ein Verletzungsrisiko durch Anprall an der Wand oder Kollision.
Wird die sichernde Person in die erste Exe hochgezogen, kann es zu Quetschungen oder Aufhebung der Blockierfunktion des Sicherungsgerätes kommen. Zudem verlängert sich der Bremsweg für den Kletterer, was insbesondere in Bodennähe zu Bodenstürzen oder Kollisionen führen kann.


Je größer der Gewichtsunterschied innerhalb einer Seilschaft, desto schwieriger wird die Kontrolle des Bremsseils beim Ablassen. Abhängig von der Situation und Erfahrung der sichernden Person ist es daher sinnvoll, ab einem bestimmten Gewichtsunterschied Maßnahmen zu ergreifen, um dieses Unfallpotenzial zu verringern.
Eine Möglichkeit, um den Gewichtsunterschied innerhalb einer Seilschaft auszugleichen, ist die Verwendung von reibungserhöhenden Geräten. Derzeit sind für diese Geräte verschiedene Bezeichnungen im Umlauf, wie Reibungsverstärker, Vorschaltwiderstände, Seilbremsen oder Bremshilfen.
In der Folge sprechen wir, dem Beschluss der Normungsgruppe der UIAA Safety Commission zur Erarbeitung einer Gerätenorm folgend, von Bremsassistenten (engl. „brake assistants“).
Untersuchung
Angestoßen durch die Diskussionen in der Normungsgruppe und der Zunahme an neuen Geräten auf dem Markt führte die DAV-Sicherheitsforschung im Rahmen einer wissenschaftlichen Abschlussarbeit (siehe Kasten auf Seite XX am Textende) eine Vielzahl an Sturzreihen unter Laborbedingungen durch. Ergänzt wurden diese durch praxisnahe Tests in der Kletterhalle.
Folgende Geräte waren Teil der Untersuchung: Zorro, Espressi Basic, Espressi Lite (Bauer); Ohm 2, Ohmega (Edelrid); Zaed (raed climbing); Assist (Mammut)
Wie funktionieren Bremsassistenten?
Die untersuchten Geräte folgen unterschiedlichen Funktionsprinzipien, um die Kraft, die bei der sichernden Person ankommt, zu verringern. Sie lassen sich in drei Gruppen einteilen.
Reibungserhöhung durch Umschlingungswinkel (Zaed und Espressi):
Das Seil läuft um ein oder mehrere feste Elemente mit Radius. Je größer der Umschlingungswinkel, desto höher die Reibung (Euler-Eytelwein-Formel). Beim Zaed lassen sich durch das Verstellen eines Bolzens drei unterschiedliche Positionen und somit Umschlingungswinkel einstellen. Das Espressi gibt es mit zwei unterschiedlichen Bremsscheiben (Basic und Lite).
Reibungserhöhung durch Quetschen mit Schlitzführung (Ohm):
Das Seil wird im Sturzfall in den Schlitz gedrückt, was die Reibung auf Grund von Kontaktpressung erhöht.

Reibungserhöhung durch Quetschung mittels Hebel (Ohmega, Assist):
Der Seilzug versetzt einen gefederten Hebel in Bewegung, der das Seil gegen eine Fläche drückt. Die Stärke, mit der der Hebel auf das Seil drückt, ist abhängig vom Hebelarm. Das Ohmega mit drei Einhängepositionen hat aus diesem Grund drei Bremskraftstufen.


in der Schlinge ermöglichen beim Ohmega unterschiedliche
Kompensationswerte (3 Stufen, am Gerät mit +/++/+++
gekennzeichnet). Das Erkennen der gewünschten Bremsstufe
erfordert etwas Übung. Foto: Janotte, Berker, Fritz
Beim Assist können zwei unterschiedliche Bremsstufen eingestellt werden: Entweder wird in eine Exe oder einen einfachen Karabiner eingehängt. Dadurch kann der Abstand zum Haken und damit der Umschlagweg variiert werden (siehe Abb.), was den Aktivierungszeitpunkt der Quetschung und somit den Kompensationswert (s.u.) beeinflusst.

Kompensationswert
In der Gebrauchsanleitung der jeweiligen Geräte geben Hersteller an, für welchen Gewichtsunterschied das Gerät geeignet ist (siehe Tab.1). Nicht bei allen ist ersichtlich, worauf genau diese Angaben beruhen. In der Normungsgruppe der UIAA wird derzeit ein Vorschlag für einen Testaufbau (Abb.6) diskutiert, um einen objektiven Kompensationswert ermitteln zu können.
Dieser Wert sagt aus, wie viel Kilogramm Gewicht durch das Gerät ausgeglichen werden können. Der Kompensationswert wird wie folgt bestimmt: In einem ersten Schritt wird ein Referenztest durchgeführt. Dafür wird bei einem Gewichtsverhältnis von 1:1 der Sicherungsmasse zu Sturzmasse (z. B. 80 kg zu 80 kg) gemessen, wie hoch die Sicherungsmasse bei einem standardisierten Sturz gezogen wird.
Anschließend wird der Bremsassistent auf Höhe der ersten Exe eingehängt und die Sturzmasse so weit erhöht, bis die Sicherungsmasse erneut die Referenzhöhe erreicht. Beispiel bei einem Sicherungsgewicht von 80 kg: Wird mit eingehängtem Bremsassistent die Referenzhöhe bei einem Sturzgewicht von 95 kg erreicht, beträgt der ermittelte Kompensationswert 15 kg.

So haben wir getestet
Mit dem Versuchsaufbau aus Abbildung 6 wurden ausgehend von einer Masse (kletternde Person) von 80 kg bzw. 40 kg mehrere Testreihen durchgeführt. Um zu untersuchen, ob ein „praxisnäherer“ Aufbau vergleichbare Ergebnisse liefert, wurden auch Testreihen mit abgeändertem Versuchsaufbau durchgeführt: Umlenkung senkrecht über dem Gerät, Sicherungsmasse mit einem Meter horizontalem Abstand zum Gerät (der 165°-Winkel wird also am ins Gerät einlaufenden Seil erzeugt).
Die Kompensation beim Sturz ins Gerät (was einem Sturz in die erste Exe entspricht) wurde ebenso ermittelt. Um den Einfluss der Seildicke miteinzubeziehen, wurden zwei Durchmesser (8,9 mm Edelrid Swift 48 Pro Dry und 10,5 mm Edelrid Tower) gewählt, die am oberen und unteren Ende der Herstellerangaben liegen (Ausnahme untere Grenze bei Ohmega 8,6 mm und Assist 8,7 mm). Das Sturzgewicht wurde in 5-kg-Schritten erhöht, bis zu dem Wert, welcher der Referenzhöhe am nächsten kommt.
Gemessen wurden unter anderem der Fangstoß (Kraft an der kletternden Person/Masse), der Sturzzug (Kraft an der sichernden Person/Masse) sowie die Kraft an der Umlenkung.
Ergebnisse
Die ermittelten Kompensationswerte sind in Tabelle 1 dargestellt. Es fällt auf: Bei den Sturzversuchen mit dickem Seil wurden bei den meisten Geräten deutlich höhere Kompensationswerte als mit dünnem Seil erzielt. In der Praxis muss dies unbedingt berücksichtigt werden. Bei einem „zu geringen“ Gewichtsunterschied bremsen die Geräte dann entsprechend „stark“, was bei passivem Sicherungsverhalten unweigerlich zu sehr harten Stürzen für die kletternde Person führt!

Bei den alternativen Versuchsaufbauten, die die Realität besser abbilden sollen, trat folgendes Problem auf: Wird die Sicherungsmasse einen Meter horizontal vom Reibungsverstärker entfernt platziert, führen die dadurch verursachten Pendelbewegungen zu starken, unkontrollierbaren Schwingungen.
Diese können die Messergebnisse erheblich verfälschen oder sogar dazu führen, dass die Geräte deaktiviert werden, wenn die Sicherungsmasse an der Wand anprallt oder unter dem Gerät durchschwingt. Die Ergebnisse zeigten bei diesen alternativen Versuchsaufbauten große Schwankungen.
Zwar waren die gemessenen Höhen im Vergleich zum originalen Versuchsaufbau teilweise etwas niedriger; jedoch konnten über alle Versuchsreihen hinweg im Vergleich zu dem originalen Versuchsaufbau keine eindeutigen Unterschiede im Ergebnis festgestellt werden.
Für einen besseren Vergleich der Geräte wurde eine Sturzreihe mit einem konstanten Gewichtsunterschied von 10 kg durchgeführt. Dabei wurden die Kräfte im Seil vor und nach dem Bremsassistenten (Abb. 8) an der Umlenkung und an der Sturzmasse (Fangstoß) sowie die Höhe der sichernden Masse nach dem Sturz gemessen. Aus den Kräften lässt sich der sog. Bremsfaktor ß ermitteln, um wieviel kN (F1-F2) die Kraft durch das jeweilige Gerät reduziert wird (Abb.7) der sich aus der Euler- Eytelwein-Formel herleitet und wie folgt definiert ist: ß (Brake Factor) = F2/F1

Damit kann eine Aussage getroffen werden, wie viel Kraft der jeweilige Bremsassistent in diesem Setup reduziert. Der Bremsfaktor korreliert signifikant mit der gemessenen Höhe des Bremsgewichts nach dem Sturz (p<0,001, r=–0.91, R2=0,83) Interessant: Obwohl beim Mammut Assist der ermittelte Kompensationswert beim Einhängen direkt in den Karabiner (Boost Mode) höher ist als beim Einhängen in die Exe, ist der Bremsfaktor bei beiden Modi gleich.
Das Gerät bremst also immer mit derselben Kraft. Nur der Aktivierungszeitpunkt der Quetschung erfolgt mit Exe durch den längeren Umschlagweg später, weswegen die Sicherungsmasse höher gezogen wird. Sturz ins Gerät (Aktiver Kompensationswert) Auch beim Sturz in die erste Zwischensicherung muss ein Bremsassistent funktionieren.

Alle Geräte erfüllen diese Forderung, nur das Zaed weist in diesem Fall keinerlei Kompensation auf, da das Seil beim Sturz ins Gerät nur um den dünnen Bolzen läuft (siehe Abb.9). Ohmega und Espressi zeigen aktiv wie passiv ähnliche Kompensationswerte, wohingegen Ohm2 und Assist eine sehr viel höhere aktive Kompensation aufweisen. Der Sturz kann damit sehr hart ausfallen – oberstes Ziel beim Sturz in die erste Zwischensicherung ist jedoch, einen Grounder zu vermeiden, weshalb eine fehlende Kompensation hier schwerer wiegt als mitunter ein harter Sturz.

Labor vs. Kletterhalle
Zusätzlich zu den Laborversuchen haben wir die Geräte in Praxisversuchen in der Kletterhalle getestet. Wie hoch wird die sichernde Person bei konstantem Sturzgewicht gezogen? Und lassen sich die im Labor ermittelten Kompensationswerte mit Personen bestätigen?
Der Gewichtsunterschied wurde durch eine Gewichtsweste dem jeweiligen Szenario entsprechend angepasst. Die ermittelten Kompensationswerte konnten bei den praxisnahen Stürzen grundsätzlich bestätigt werden. Im Vergleich zur Referenzmessung der Laborversuche wurde die sichernde Person beim Espressi etwas weniger hochgezogen; auch bei Ohmega und Assist gab es kleinere Abweichungen.
Allerdings sind bei Praxistests trotz definierter gleichbleibender Parameter wie Sturzhöhe, passiver Sicherung, Abstand zur Wand usw. stets mehr unkontrollierbare Variablen im Spiel als bei Laborversuchen wie z. B. das Absprung-/Sturzverhalten und das Sicherungsverhalten. Wir gehen davon aus, dass man bei den im Labor ermittelten Werten mit dünnem Seil von einem Mindestmaß an erreichbarer Kompensation ausgeht und diese in der Praxis oft höher ausfällt.

Aktiv-dynamisch sichern
Mit Bremsassistenten kann also bei einem Gewichtsunterschied (je nach Gerät und Einstellung in unterschiedlich hohem Maße) erfolgreich die Sturzweite reduziert werden – die sichernde Person wird weniger hochgerissen. Doch was bedeutet das für die stürzende Person? Je stärker ein Gerät bremst, desto härter und unangenehmer wird der Sturz für die stürzende Person – so die Theorie.
Dies wurde auch durch die Kraftmessungen in den Versuchen bestätigt. Für die Praxis bedeutet das: um den Sturz angenehm zu gestalten, sollte man aktiv weich sichern (so wie es auch für einen hohen Gewichtsunterschied bei einer schwereren sichernden und leichteren kletternden Person empfohlen wird). In unseren Praxisversuchsreihen konnte mit allen Bremsassistenten weich gesichert werden.
Die gemessene Kraft an der Umlenkung konnte bei allen Geräten durch aktiv-dynamisches Sichern auf einen ähnlich niedrigen Wert reduziert werden. Beachtet werden sollte dabei der Umschlagweg des Gerätes, wodurch sich das richtige Timing beim köperdynamischen Sichern im Vergleich zum Sichern ohne Bremsassistent verändern kann. Das muss berücksichtigt werden und erfordert Übung mit dem jeweiligen Gerät.

Winkelabhängigkeit
Damit beim Klettern im Vorstieg beim Seilhochziehen zum Clippen kein Widerstand entsteht, ermöglicht die Bauart der Geräte ein reibungsarmes Durchlaufen des Seils in Ruheposition. Für die Aktivierung braucht es einen Seilzug auf Seite der sichernden Person sowie einen Knick im Seilverlauf. Erst die dann wirkende Vektorkraft aktiviert das Gerät.
In allen Gebrauchsanleitungen (ausgenommen der Geräte von Bauer, da bei diesen nicht erforderlich) steht, dass die sichernde Person mindestens einen Meter Abstand zum eingehängten Gerät einhalten soll – nicht nur zur Wand (wichtig, wenn die erste Exe im Überhang hängt). Im Sturzfall wird die sichernde Person allerdings hochgezogen, was den Winkel verkleinert und somit (minimal später) auch zur Aktivierung führen kann.

Kritisch kann es werden, wenn die sichernde Person (aufgrund eines Überhangs) unter dem Gerät bzw. der ersten Exe „durchschwingen“ kann. Bei einem Winkel von 180° zwischen dem in das Gerät einlaufenden und dem aus dem Gerät auslaufenden Seil aktivieren die Bremsassistenten nicht bzw. sehr unzuverlässig – das wurde mit Sturzversuchen überprüft.
Das Zaed entfaltet nur in einem kleinen Winkelbereich die volle Bremswirkung: Bei einem Winkel zwischen 145° und 165° volle Bremswirkung, <145° verminderte Bremswirkung, <125° keine Bremswirkung. In der Gebrauchsanleitung steht, dass das Gerät nur bis zu einem maximal 55° steilen Überhang verwendet werden darf. „Startet“ die Route hingegen mit einer Platte, kann man Schwierigkeiten bekommen, die Person überhaupt abzulassen, da sich bei einem größeren Winkel (>180°) der Kompensationswert erhöht.
Alle Eventualitäten konnten wir noch nicht ausführlich untersuchen – wichtig ist demnach ein bewusster und situativ-aufmerksamer Einsatz der Geräte vor allem beim Klettern draußen. Offen sind unter anderem noch die Fragen, was passiert, wenn sich der Winkel verändert, weil die Person weiter weg von der Wand steht oder wenn die Route diagonal/mit einem Quergang startet.
Zusätzliche Faktoren in der Praxis
Im Prinzip müssen beim Klettern mit Bremsassistenten all die Dinge berücksichtigt werden, die das Sichern und den Gewichtsunterschied einer Seilschaft sonst auch beeinflussen! Dies ist die Grundlage dafür, inwieweit der Gebrauch des Bremsassistenten in der jeweiligen Konstellation sinnvoll und empfehlenswert ist.
Handelt es sich zum Beispiel um eine Route am Felsen, die durch eine „Zickzack“-Linienverlauf mehr Seilreibung erzeugt, kann es sein, dass ein Bremsassistent nicht notwendig ist, zu harten Stürzen führt, oder dazu, dass man die kletternde Person nicht mehr ablassen kann. Diese Thematik wird durch Seildicke, Seilbeschaffenheit (abgenutzt, aufgepelzt) und hohe Luftfeuchtigkeit noch verstärkt. Beispiel: Besteht im Klettergarten in einer Seilschaft ein Gewichtsunterschied von 15 kg bei einer nicht geraden Linienführung mit einem alten dicken Seil, ist der Einsatz eines Bremsassistenten nicht unbedingt sinnvoll.
Handling & Funktion
Die reinen Kompensationswerte sind das eine – wie aber lassen sich die Geräte bedienen und welche „Tücken” und Besonderheiten sind bei der Handhabung zu beachten?
Installation/Bedienung einhändig
Möchte man das Gerät nicht jedes Mal neu ein- und aushängen (mehrmaliges Klettern in einer Linie), sollte das Seil einhändig einlegbar sein. Am angenehmsten ist die einhändige Bedienung beim Mammut Assist, gefolgt vom Ohm. Bei allen anderen Geräten gestaltet sich das einhändige Einhängen schwierig – bis hin zu unmöglich, und bedarf ziemlich viel Übung! Die neue Version des Bauer Espressi hat als Verschluss einen Bolzen mit Druckknopf.
Die Bedienung wurde dadurch vereinfacht, dennoch ist das Einlegen etwas hakelig – wer nicht aufpasst, kann das Seil auch abgeklemmt einlegen. Ebenfalls mit Bolzen und Druckknopf lässt sich das Zaed recht einfach bedienen. Das Ohm hat einen Druckknopf, der sich leicht bedienen lässt. Das Assist lässt sich durch einen Schiebeknopf gut öffnen – positiv: die Kennzeichnung zur korrekten Einlegeposition des Seils ist im geöffneten und geschlossenen Zustand ersichtlich.
Seil falsch eingelegt

Wenn das Seil falschherum eingelegt wird, haben die Geräte abhängig von der Bauart entweder keinerlei Kompensationswirkung (Zaed, Ohmega und Assist), wenig Kompensationswirkung (Ohm) oder die volle Kompensationswirkung (Bauer- Geräte Espressi & Zorro). Und die kletternde bzw. sichernde Person erkennt auch nicht gleich bei allen Geräten, ob das Seil falsch eingelegt wurde. Deshalb: Das korrekte Einlegen in den Partnercheck integrieren!
Zumachen und Weiterklettern (Deaktivieren)
Etwas unpraktisch: Möchte man eine Stelle ausbouldern (Kommando „Zu“), muss der Umschlagweg des Geräts berücksichtigt werden. Damit das Gerät vollständig aktiviert, muss die sichernde Person nach dem Seileinholen und Zumachen ca. 30 bis 50 Zentimeter nachgeben, d. h. der Wand entgegengehen. Das führt dazu, dass die kletternde Person immer ein Stück nach unten zurücksackt. Zum Deaktivieren bei allen Geräten das gleiche Spiel: Kurz am Seil „schlackern“ und das Gerät deaktiviert und klappt nach unten in die Ausgangslage zurück.
Seilzug Klettern/Fehlauslösung
Ungewünscht wäre es, wenn die kletternde Person beim schnellen Seilhochziehen zum Clippen das Gerät aktiviert und dadurch ein Widerstand entsteht. Diese Problematik konnte in der Vergangenheit bei schlitzbasierten Geräten wie dem Ohm festgestellt werde. Mit der neueren Version (Wirbel beim Ohm 2) passiert dies seltener, ist aber weiterhin möglich. Die Geräte mit Umschlingungswinkel lassen einen schnellen Seildurchlauf zu, wobei die Bauer-Geräte in jeder Position durch den Seilverlauf etwas mehr Reibung als ein Karabiner aufweisen.
Die gelagerte Seilrolle des Ohmega sorgt für weniger Widerstand als bei einer Expressschlinge. Auch das Assist lässt sich beim Seilhochziehen kaum aktivieren. Beachte: Sobald die sichernde Person ein wenig Zug am Seil ausübt, aktivieren alle Geräte.
Ablassen
Beim Ablassen ist Vorsicht geboten. Damit das Gerät vollständig umschlagen und somit aktivieren kann, kann es helfen, sich als Kletternder schwungvoll ins Seil zu setzen. Bei zaghaftem Reinsetzen kann es passieren, dass die sichernde Person langsam an die Wand unter das Gerät gezogen wird und der Bremsassistent dann nicht aktiviert wird.

Besonders unter Überhängen kann es schwierig werden, den benötigten Winkel zum Aktivieren des Gerätes wiederherzustellen – beispielsweise durch Abdrücken von der Wand. Mit Messungen von Kraftverläufen an der sichernden Person haben wir uns den Ablassvorgang genauer angesehen.
Beim Ablassen mit Ohm konnten unregelmäßigere und höhere Belastungen festgestellt, was darauf hinweist, dass damit gleichmäßiges, ruckelfreies Ablassen etwas schwerer durchführbar ist. Am geringsten und ähnlich dem Ablassen mit Exe in der Zwischensicherung waren die Kraftwechsel logischerweise beim Zaed (Stufe 1), dieses hat schließlich auch die geringste Bremswirkung.
Route abbauen
In den Gebrauchsanleitungen der Hersteller (ausgenommen beim Zaed) sind Hinweise zum empfohlenen Vorgehen beim Routenabbau zu finden. Um den Bremsassistenten nach dem Klettern wieder auszubauen, gibt es folgende Möglichkeiten:
- Stopp beim Ablassen an der ersten Zwischensicherung. Einhängen (ggf. eigene Exe mitnehmen), Bremsassistent entfernen, Zumachen, Ablassen. Aber Vorsicht: Die sichernde Person kann dann vom plötzlichen Mehrgewicht „überrascht“ werden. Für die letzten Ablassmeter wird der Gewichtsunterschied nicht ausgeglichen! Diese Vorgehensweise ist bei hohen Gewichtsunterschieden nicht zu empfehlen!
- Nach dem vollständigen Ablassen wird noch einmal von unten bis zum Gerät geklettert, um es herauszuholen. Lässt es die Situation risikoarm zu (niedrige erste Zwischensicherung), dann am besten wieder abklettern. Wenn nicht, macht es Sinn, wenn die leichtere Person im Toprope das Gerät aus der Wand holt (erneutes Einbinden samt Partnercheck!).
- Am ersten Haken (oder nahgelegenen zweiten Haken) fixieren, Gerät aus dem Haken nehmen und zu sich an die Anseilschlaufe hängen. Ein Gewichtsausgleich findet dann weiterhin statt. Aber Vorsicht: Die letzten Zentimeter vorsichtig ablassen. Kletternde und Sichernde werden zueinander gezogen – ist die Route nicht senkrecht, herrscht Pendel sowie Anprallgefahr an Absätzen.
Zusammenfassung
Bremsassistenten können das Sichern schwererer Kletterpartner* innen spürbar erleichtern und die Sicherheit erhöhen. Die ermittelten Kompensationswerte bieten dabei einen objektiven Vergleich der Bremswirkung der verschiedenen Geräte.
Dennoch sind diese Werte nicht in Stein gemeißelt – Seildicke, Seilbeschaffenheit, Routenverlauf und sogar Luftfeuchtigkeit beeinflussen die Bremswirkung und sollten bei der Anwendung immer berücksichtigt werden. Den größten Einfluss hat jedoch die sichernde Person selbst: Gutes Sichern ist anspruchsvoll, gerade sonst leichte Sichernde, die aktiv-dynamisches Sichern nicht gewohnt sind, sollten mit Bremsassistenten ihr Sicherungsverhalten gezielt anpassen, Feedback einholen und üben.
Der eigentliche Zweck von Bremsassistenten ist es, einen schweren Kletterer „leichter zu machen”. Schaut man über den Tellerrand hinaus, könnten die Geräte zum Beispiel auch für fortgeschrittene Sicherungstechniken wie der Sensorhanddynamik eingesetzt werden. Durch den Bremsassistenten kann das Gewicht der kletternden Person so reduziert werden, dass in einer entsprechenden Konstellation das Sichern mit Sensorhand möglich wird.