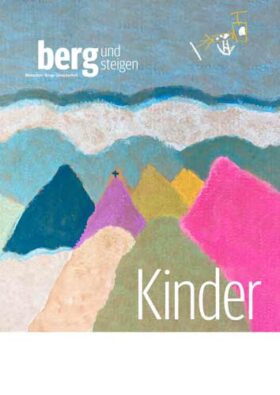FOMO, Social Media & Alpinismus
Die Videos ähneln sich in ihrer Machart. Sie zeigen Menschen, die etwas Krasses tun. Eisklettern zum Beispiel. Man hört schweres Atmen. Dazwischen sagen die Menschen Sachen wie: „Woahh“, „Oh my god“, „Fuck!“ oder „Looks great“. Manchmal kleben sie in slow motion Steigfelle auf Skier. Oder sie blicken mit kantigem Gesichtsausdruck zu einem fernen Horizont.

Am Gipfel klatschen sie sich ab. Dann stürzen sie sich Rinnen hinunter. Oder Hänge, über denen Wechten dräuen. Sie kurven schneeumstiebt durch Powder, begleitet von hämmernder „motivatio nal music“, im Zweifel auch von Geigen klängen. Die Botschaft scheint eindeutig: Hier passiert etwas Heroisches. Es gibt diese Videos im Netz in allen Variationen: als Solokletterei, MTB-Downhill Ritt oder Wingsuitflug. Nicht nur Profis, sondern auch Amateure breiten hier tausend- und abertausendfach ihre Bergsporterlebnisse aus – wenn auch in weniger extremer Form.
Es ist nichts dagegen einzuwenden, dass Menschen starke Eindrücke in der Natur erleben wollen. Dass sie in die Ferne schweifen und in die Höhe streben. Es ist verständlich, dass sie der Faszination der Berge erliegen. Deren Mächtigkeit und Höhe macht sie für viele so reizvoll. Berge bilden Grenzbereiche, mancherorts noch Wildnis. Bergsteiger suchen Schönheit, Erhabenheit, Kameradschaft ebenso wie Einsamkeit, manchmal eine Erfahrung an den Grenzen ihrer physischen Existenz.
Das alles ist legitim. Es ist auch nicht verwerflich, wenn Menschen von ihren Erlebnissen in Schrift und Bild berichten. Seitdem es den Alpinismus gibt, zeugen unzählige Regalmeter an Abenteuerbüchern von Heldinnen und Helden, die von ihren Siegen und Dramen erzählen. Schon die Pioniere des Alpinismus, Edward Whymper zum Beispiel oder die den Himalaya erforschenden Gebrüder Schlagintweit, dokumentierten ihre Expeditionen akribisch.
Wobei sie sich weniger selbst inszenierten, als vielmehr die Welt verstehen und erschließen wollten. Dieser Impuls änderte sich mit dem Aufkommen der Konsumgesellschaft im 20. Jahrhundert. In ihr rückt das Individuum in den Mittelpunkt. Identität wird zunehmend über Lifestyle und Konsum definiert – auch den Konsum von Erlebnissen. Mit der schier unendlichen Verbreitungsmöglichkeit in den sogenannten sozialen Medien hat auch das alpine Geschichtenerzählen eine völlig neue Dimension gewonnen.
Denn mit den digitalen Plattformen findet sowohl jeder „Verrückte“ als auch „Durchschnittliche“ sein Podium. Und damit auch sein Publikum. Zugleich ist in der digitalen Ära das Individuum nicht nur Subjekt, sondern immer auch Produkt. Likes und Follower werden zu Indikatoren für persönliche Bedeutung. Zwar werden all die online verfügbaren Videos und Fotos „geshared“, also geteilt.
Doch mit teilen im Sinne von teilhaben lassen hat das massenhafte Sendungsbewusstsein wenig zu tun. Ein häufig eintretender Effekt ist, dass sich die Rezipienten der Ich-Botschaften nicht beschenkt fühlen, sondern vielmehr von dem tiefen Unbehagen, ja von der Panik befallen werden, das wahre, das lebendige Leben sei da, wo die anderen sind. Und nicht dort, wo man gerade selbst ist: eingezwängt im Alltag, vielleicht knapp bei Kasse, mit einem Schnupfen auf dem Sofa, jedenfalls weit weg von Abenteuer, Exotik oder gar Thrill.
So lässt jeder Post die Furcht aufkeimen, all die Reisen und Landschaften, die andere plakativ ausbreiten, nie selbst erleben und sehen zu können. FOMO, fear of missing out, wird dieses Phänomen genannt.
Angst vor sozialem Ausschluss
Dr. Elisa Wegmann arbeitet als Kognitionswissenschaftlerin an der Universität Duisburg-Essen und forscht zu dieser Verhaltensauffälligkeit, die seit zehn Jahren wissenschaftlich untersucht wird. Ihr Forschungsobjekt definiert Wegmann so: „FOMO beschreibt die Angst, lohnende soziale Erfahrungen zu verpassen, was wiederum zu einer immer intensiveren Social-Media-Nutzung führen kann. Die Betroffenen versuchen auf diese Art an Erfahrungen teilzuhaben, die sie nicht real erleben können.“
Zum bergundsteigen-Artikel „Angst etwas zu verpassen„
Dabei sei der Wunsch, sich der Zugehörigkeit zur eigenen Gruppe zu vergewissern, nichts Krankhaftes. „Das Bedürfnis, sozial eingebunden zu sein, ist uns Menschen eingeschrieben“, sagt Elisa Wegmann. „Problematisch wird es erst, wenn dieses Bedürfnis nach Inklusion einen angstgetriebenen Charakter bekommt.“ Von FOMO im Zusammenhang mit einer exzessiven Social-Media Nutzung spricht man, wenn Menschen in einen solchen Sog geraten, dass sie ihre Alltagsverrichtungen für ständige Checks sozialer Kanäle unterbrechen und zunehmend länger auf den Plattformen verweilen.
Wer nicht mehr auf Tuchfühlung mit sich selbst ist, sondern nur das Ziel verfolgt, ein noch aufregenderes Leben zu inszenieren, droht eines Tages daran zu zerbrechen, ja sich selbst zu gefährden.
Die sozialen Medien werden so zur digitalen Nabelschnur für ein Erleben aus zweiter Hand. Zusätzlich erzeugen die Plattformen den Druck, Posts sofort anzuschauen, da Inhalte nur für eine befristete Zeit abrufbar sind. Die Dauerberieselung befeuert ein ständiges Abgleichen des eigenen Lebens mit dem Leben anderer. FOMO umfasst also sowohl die Angst, reale Erfahrungen zu verpassen, als auch die Furcht, nicht auf dem Laufenden darüber zu sein, was andere unternehmen.
„Wir beobachten, dass FOMO in gesteigerter Form bei Menschen auftritt, die ein höheres Risiko für Depressionen, Ängste und Konflikte mit ihrer sozialen Umgebung haben“, sagt Wegmann. Ursächlicher Treiber ist die Vorstellung, dass andere Spaß, Gemeinschaft, Erfolg und Anerkennung erleben, während man selbst außen vor bleibt.
Ich häng dich ab! – Selbstaufwertung durch soziale Abgrenzung
Das Urbedürfnis nach Kontakt und Zugehörigkeit begleitet uns als Menschen und Säugetiere seit vorgeschichtlicher Zeit. Aber echte Verbundenheit findet in unserer konkurrenz- und leistungsorientierten Gesellschaft nur wenig Platz. Stattdessen soll man ständig sein „best possible self“ präsentieren. Ein soziokulturelles Phänomen wirkt dem Wunsch nach Dazugehören besonders entgegen: der Distinktionsgewinn.
Hinter dem sperrigen Namen steckt das Streben, einen Vorsprung vor seinen Mitmenschen zu haben, diese auf Abstand zu halten, ihnen das Gefühl zu geben, ins Hintertreffen zu geraten. Der französische Soziologe Pierre Bourdieu hat sich in den 1970er-Jahren mit dieser Technik der sozialen Abgrenzung befasst. Er zeigte auf, dass Distinktion, soll sie wirken, auch sichtbar gemacht werden muss, beispielsweise durch den Erwerb statusgeladener Objekte oder das Zurschaustellen eines Lebensstils.
Distinktion bedient den In- und Outgroup-Effekt, indem sie vermittelt: „Ich gehöre zu dieser Gruppe – und du nicht.“ Distinktionsgewinn zeigt sich auch im Verbreiten passender Narrative. Wichtig ist dabei, die Erzählungen an die eigene Bezugsgruppe zu adressieren. Jemandem, der gern in einem All-inclusive-Resort Urlaub macht, von einer heiklen Fels-Eis-Mixed-Tour zu erzählen, wird wenig Wirkung zeigen.
Und spirituelle Sinnsucher punkten in ihrer Community besser mit Geschichten aus Ashram bei Meistergurus. Ziel ist immer, sich in der Hierarchie der eigenen Community nach oben zu bewegen. Stephan Orth, Autor von „Couchsurfing im Iran“, beschreibt dieses Phänomen selbstironisch: Wer unter Backpackern wirklich punkten will, muss in Länder reisen, für die es eine Reisewarnung gibt.

Afghanistan bringt mehr „Punkte“ als Kuba. Die geposteten Fotos sind dabei die eigentlichen Träger der Botschaft. Der Blick durch die Linse, geschult durch Werbeanzeigen der Outdoor Industrie, inszeniert und kuratiert die Botschaft. Scheußliches und Banales bleibt dabei außen vor. Me, Myself and I werden mit dem Selfiestick vor dem richtigen Hintergrund platziert. Raum und Erleben bekommen etwas Exklusives: Wo ich bin – und du nicht.
Der Schweizer Psychoanalytiker Arno Gruen beschrieb es so: „Distinktions denken ist Gewalt.“ Denn es lenkt den Blick weg von den wirklich wichtigen Dingen wie Teilhabe, Freundschaft und gelungener Kommunikation. Dabei beurteilte Gruen Distinktionsstreben nicht als Zeichen von Stärke, sondern als Symptom innerer Unsicherheit und Abhängigkeit.
Kerstin Uvnäs-Moberg ist Professorin für Physiologie, bekannt wurde die Schwedin für ihre bahnbrechende Forschung zum Hormon Oxytocin und dessen Bedeutung für soziale Bindungen und Stressreduktion. Sie beschreibt ein Phänomen: Wenn eine Person Vorfreude und etwas Aufregung in Erwartung eines Gesprächs empfindet, schüttet der Körper zunächst Oxytocin aus, aber auch Cortisol, ein Stresshormon.
Bleibt die Person jedoch auf ihrer Hoffnung sitzen, weil das Gegenüber nicht in Resonanz mit ihr tritt, sondern lediglich Informationen übermittelt, sinkt der Oxytocinspiegel, während der Cortisolspiegel steigt. Zurück bleibt Frust. „Die Suche nach Nähe über soziale Medienkanäle ist zum Scheitern verurteilt“, sagt Forscherin Uvnäs-Moberg.
„Wir sind biologische Wesen und können unser Bedürfnis nach Zugehörigkeit nur stillen, wenn wir wirklichen Kontakt herstellen, die Stimme des an deren hören, ihm in die Augen schauen oder ihn berühren.“ Wer nicht mehr auf Tuchfühlung mit sich selbst ist, sondern nur das Ziel verfolgt, ein noch aufregenderes Leben zu inszenieren, droht eines Tages daran zu zerbrechen, ja sich selbst zu gefährden.
Dazu sagt die Kognitionswissenschaftlerin Elisa Wegmann: „Es könnte sein, dass die Kombination aus FOMO und dem Wunsch nach Distinktionsgewinn die Entscheidung begünstigt, sich auf riskante Unternehmungen einzulassen, und das Posten solcher Aktivitäten wiederum FOMO bei anderen Menschen auslöst.“ Darauf verweist eine US-amerikanische Studie zum „ Risikotourismus“ von Michelle R. Holm und Kollegen, erschienen 2017 in der Zeitschrift „Tourism Management“.
Der Begriff „Risikotourismus“ bezeichnet dabei Aktivitäten, bei denen der Teilnehmer in Kauf nimmt, dass der Mangel an Fertigkeit, dem Risiko zu begegnen, eine gravierende körperliche Verletzung oder sogar den Tod mit sich bringen kann. Die Macher der Studie beschreiben folgenden Effekt: „Reisen bringen ein gesteigertes Bewusstsein für die Flüchtigkeit des Augenblicks hervor. Dies führte dazu, dass Einzelpersonen erlebten, was einige als ‚FOMO‘ (fear of missing out) bezeichneten.
Ermutigt von anderen Reisenden, aus Angst, etwas zu verpassen, und mit dem Wunsch, eine neue Identität zu formen, wurden Einzelpersonen offener für verschiedene Reiseerfahrungen, selbst wenn diese als leicht riskant wahrgenommen wurden.“
Das Unverlierbare
Wer merkt, dass sich bei ihm FOMO einschleicht, dem eröffnet sich ein Ausweg, nämlich sich auf sich selbst zu konzentrieren. Damit ist keine Nabelschau gemeint, sondern eine Selbstbefragung: Warum springe ich so an auf das, was andere tun?
Wonach hungert mich wirklich, wenn mich die Jagd nach neuen Erlebnissen nie sättigt? Um ein Eingeständnis kommt man dabei nicht herum: nämlich anzuerkennen, dass die Angst, etwas zu verpassen, weniger durch äußere Umstände – wie Aktivitäten oder Posts anderer – gesteuert wird, sondern mit den eigenen inneren Bedürfnissen zu tun hat. Bisher gibt es keine dezidierte Anti FOMO-Therapie.
Betroffenen wird der Rat gegeben, verschiedene Kanäle nicht mehr zu abonnieren, Achtsamkeitsübungen zu machen und sich in „JOMO“ zu üben, der „joy of missing out“. Nun sind aber Dankbarkeitstagebücher und Atemübungen nicht jedermanns Sache. Vielleicht liegt für Bergliebhaber das Heil mehr im Kern des Bergsteigens: dem intensiven, analogen Erleben von Natur und Gemeinschaft.
Schon Walter Bonatti betonte in seinen Schriften, dass der wahre Wert des Bergsteigens im persönlichen Erlebnis liege und nicht in dessen öffentlicher Wahrnehmung. Wahre Höhe misst sich eben nicht in Metern oder Followern, sondern in den Momenten, die uns mit uns selbst und unserer Umgebung verbinden. Und diese glücklichen Augenblicke sollte man nicht zu Posts verwursten, sondern bewusst leben: die Freude am eigenen Körper im Kontakt mit dem Fels.
Vielleicht liegt für Bergliebhaber das Heil mehr im Kern des Bergsteigens: dem intensiven, analogen Erleben von Natur und Gemeinschaft.
Das „Schhhh“, wenn Skier durch Oberflächenreif gleiten. Das wilde Entzücken über einen Tiefblick. Die Dohle, die sich auf schnellen Schwingen in die Luft wirft. Oder der kleine Kloß im Hals auf dem ersehnten Gipfel, wenn wir aus dem Mund eines Menschen, der uns wichtig ist, hören: „Berg Heil!“ Dann weicht die Angst und macht Platz für das Unverlierbare, das uns die Berge schenken können.