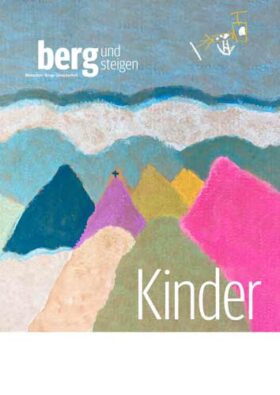Notfall Alpin (10/13): Ablaufschema Lawinenverschüttung
alle Artikel der Serie: Notfall Alpin
- Teil 1: Die ersten 5 Minuten (Ausgabe #99)
- Teil 2: Atmung und Kreislauf (Ausgabe #100)
- Teil 3: Einsatz des AEDs durch Notfallzeugen am Berg (Ausgabe #101)
- Teil 4: Erste Hilfe nach einer Lawinenverschüttung – Time is brain! (Ausgabe
#102) - Teil 5: Kritische Blutung z.B. nach einem Spaltensturz (Ausgabe #103)
- Teil 6: Erste-Hilfe-Material zur Blutstillung (Ausgabe #103)
- Teil 7: Neurologisches Problem (Ausgabe #104)
- Teil 8: Neurologisches Problem (D). Teil 2 be FAST (Ausgabe #108)
- Teil 9: E-Problem nach Skisturz (Ausgabe #109)
- Teil 10: Ablaufschema Lawinenverschüttung (Ausgabe #110)
- Teil 11: Pandemie – quo vadis? Teil 1; Teil 2 (Ausgabe #111)
- Teil 12: A/B-Problem bei allergischen Reaktionen (Ausgabe #112)
- Teil 13: Eine Frage der Kommunikation? (Ausgabe #113)

Warum also jetzt diesen Beitrag? Dafür gibt es folgende Gründe:
- Weil wir in bergundsteigen #102 unter dem Titel „Erste Hilfe nach einer Lawinenverschüttung: Time is brain!“ zwar den kompletten Ablauf nach einem Lawinenunfall – vom Notruf, über die LVS-Suche bis zur Ersten Hilfe – beschrieben haben, allerdings ohne Ablaufschema bzw. -algorithmus.
- Um die drei häufigsten Situationen nach einer Lawinenverschüttung strukturiert darzustellen: einerseits als Vorlage für Trainingsszenarien, zum anderen und vor allem aber, um im Ernstfall eine Handlungsempfehlung zur Verfügung zu stellen. Mit dem Ziel, sich auf einen möglichen Lawinenunfall (gedanklich) bestens vorbereiten zu können, um dann unter Stress die notwendigen Ressourcen frei zu haben.
- Um einen fließenden Übergang von der Kameradenrettung durch Ersthelfer zu dem für professionelle Retterinnen entwickelten ICAR-Algorithmus (Avalanche Victim Ressuscitation) zu schaffen bzw. darzustellen (vgl. Schema unten).
- Weil wir es gut finden, wenn auch der Ersthelfer eine „gemeinsame Sprache“ durch alle Glieder der Rettungskette hinweg kennenlernt und versteht.
- Um aus den veröffentlichten Studien und Daten sowie den vielen herumschwirrenden Lehrmeinungen eine Handlungsempfehlung als „Best Practice“ für den geschulten (Erst-) Helfer zugänglich zu machen.
Gut, du hast die verschüttete Person also geortet, den Kopf freigeschaufelt und startest mit deinen Erste-Hilfe-Maßnahmen. Hier können sich zwei Situationen ergeben:
- Patient ist ansprechbar, also er redet ganz normal mit dir.
- Patient ist nicht ansprechbar, er zeigt also keinerlei Reaktionen auf dein Ansprechen, Berühren, Zwicken usw.
Situation 1. Patient ist ansprechbar
Hier startest du ganz normal mit dem bekannten ABCDE-Schema und es gibt erst einmal keinen Grund zu Eile und schon gar keinen, den Patienten „hektisch“ irgendwohin zu bergen/retten. Es kann sein, dass seine Skier bzw. das Snowboard, Stöcke, Rucksack usw. den Verschütteten sehr stören, d.h. an dieser Stelle schon mal alles lösen/öffnen, was im Weg ist, und dann mit A beginnen.
A Da der Patient spricht, sind hier keine Airway/Atemwege-Problem zu erwarten. Aufgrund der Kraft und Gewalt, die auf den Patienten während des Lawinenabgangs wirkt, ist aber an die Halswirbelsäule zu denken. Du stabilisierst diese also achsengerecht mit deinen Händen ( #109).
B In B (Breathing/Atmung) gilt es die Atemfrequenz (AF) und Atemqualität (siehe bergundsteigen #99) zu eruieren und nach Verletzungen zu suchen.

C In C (Circulation/Kreislauf) geht es um den Kreislauf und Blutungen (siehe bergundsteigen #100). Blutungen nach außen gehören gestoppt (siehe bergundsteigen #103 & bergundsteigen.blog-Beitrag). Innere Blutungen kannst du leider nicht wirklich versorgen. Ganz wichtig ist an dieser Stelle aber der Wärmeerhalt: Die körpereigene Blutstillung (Gerinnung) funktioniert nämlich nur dann gut, wenn die Temperatur so normal wie möglich ist, unbedingt aber über 35 °C – (Kälte-)Zittern gilt hier bereits als Gefahrenzeichen.
Zusätzlich zum Schutz vor weiterem Auskühlen unterstützt du bereits durch funktionierendes A & B die körpereigene Blutstillung (mehr Infos dazu findest du unter: „Letale Trias“ in der Trauma-Versorgung). → Wärmeerhalt in C: Kopf abtrocknen und Mütze aufsetzen, mit Daunenjacke zudecken und Kapuze über den Kopf ziehen.
D In D (Disability/Neurologischer Status) ist der Neurocheck angesagt, denn Lawinen können zu Schädel-Hirn-Traumen (SHT) führen. Um diese nicht zu übersehen ist es wichtig, D gut abzuarbeiten (siehe bergundsteigen #104). Dabei soll eine große Lawine, die noch dazu durch bewaldetes oder felsdurchsetztes Gelände führt oder in einem Graben o.Ä. endet, aufgrund der zu erwartenden Verletzungswahrscheinlichkeit deine Alarmglocken schrillen lassen.
E In E (Else, Environment/äußere Einflüsse) verbessern wir den Wärmeerhalt durch einen Biwacksack, eine Rettungsdecke oder ähnliche Materialen. Wie viel Aufwand du hier betreibst, hängt auch davon ab, wann die professionellen Rettungskräfte eintreffen werden: Je kürzer diese Wartezeit ist (Heli unterwegs), desto weniger notwendig ist es, die Lagerung des Patienten jetzt noch großartig zu verändern.
Ein tatsächliches Retten aus dem Verschüttungsraum (VR, also dem „Loch“, in dem der Verschüttete nach dem Ausschaufeln liegt) ist nur bei ungünstigen „Kopfüberlagen“ u.Ä. notwendig. Dann bietet es sich an, den Patienten auf die bereits freigeschaufelte Rampe achsengerecht und ohne viel Manipulation (HWS!) zu bewegen – also eine sogenannte „schonende Rettung“.
Situation 2: Patient ist nicht ansprechbar
In diesem Fall ergeben sich nochmals zwei Möglichkeiten:
- Patient atmet (normal)
- Patient atmet nicht (normal)
„Normale Atmung“ heißt:
Nach dem ggf. notwendigen Freilegen der Atemwege (Schnee, Erbrochenes) und Überstrecken des Kopfes (Chinlift) ist die Atmung durch regelmäßige Brustkorbbewegungen in einer ausreichenden Frequenz (10/Minute oder mehr) mithilfe von Hören, Sehen und Fühlen messbar. Im Zweifelsfall oder bei Unsicherheit ist von „keiner Atmung“ auszugehen (siehe bergundsteigen #100).
„Keine normale Atmung“ bedeutet:
Die Atmung ist entweder zu langsam (AF < 9/ Minute), kaum sichtbar (Oberkörper hebt/ senkt sich nicht) oder viel zu schnell (AF > 30/Minute). Wenn sich der Brustkorb normal schnell und gut sichtbar hebt und senkt, 2 du aber keinen Atemzug (Atem-Hauch) durch fühlen wahrnimmst, überprüfe die Atemwege erneut und entferne ggf. nochmal Schnee, Erbrochenes, o.Ä. und kontrolliere nochmals die Überstreckung/Chinlift des Kopfes. → Keine normale Atmung führt zum Beginn der Reanimation/CPR (siehe bergundsteigen #101)
Beide Möglichkeiten sind wesentlich brisanter als beim „ansprechbaren Patienten“ und erfordern unbedingt dein richtiges Handeln: der Patient ist absolut bedroht und es herrscht Lebensgefahr! Dennoch gilt es, weder in Hektik noch in einen Actionmode zu fallen, sondern besonnen, schnell und mit einem guten Plan vorzugehen (10 für 10)! Dabei gilt – wie überall in der Ersten Hilfe und überhaupt am Berg: „Slow is smooth, and smooth is fast!“
Patient atmet (normal)
Du arbeitest wieder das ABCDE-Schema ab. Augenmerk ist hierbei in A das Offenhalten der Atemwege, idealerweise durch einen Chinlift (Abb. 1), auch bekannt als Esmarch Handgriff (siehe bergundsteigen #100). Zusätzlich richtet sich dein Fokus auf B (Breathing/Atmung), indem du dir fortlaufend die Frage stellst und kontrollierst, ob Atemfrequenz und -tiefe noch ausreichend sind. In C gehst du genauso vor wie in Situation 1 („Patient ist ansprechbar“), selbiges gilt für D und E. Speziell ist, dass der gefährdete Atemweg (Airway) händisch offengehalten werden muss. Als Komplikation besteht das Risiko, dass die Atmung nicht mehr als „normal“ eingestuft wird. Deswegen gilt für dich:
- Verlasse die Kopfposition nicht.
- Versuche den Patienten in eine stabile Seitenlage oder Rückenlage mit der Möglichkeit zum Log-Roll zu bekommen (siehe bergundsteigen #99).
- Stelle eine CPR-Bereitschaft her, d.h. eine feste/harte Plattform für die Thorax-Kompressionen.
- Der Patient wird so schnell als möglich vom weiteren Schnee befreit und vorsichtig sowie achsengerecht auf die Rampe bewegt
– also eine sogenannte „schnelle Rettung“. Im Anschluss wird ABCDE fortlaufend evaluiert und nach weiteren Verletzungen und Auffälligkeiten gesucht, insbesondere Blutungen in C (Stichwort Wärmeerhalt) und SHT in D (siehe bergundsteigen #101).
Patient atmet nicht (normal)
→ Keine (normale) Atmung bedeutet CPR (Cardiopulmonale Reanimation).
Das ist dein Worstcase, der eintritt, wenn du folgende zwei Fragen negativ beantworten musst:
- Antwortet der Patient? Nein, keine Antwort!
- Atmet der Patient? Nein, keine Atmung!
Absolute Priorität haben jetzt:
- Beatmung in A und B
- Thorax-Kompressionen in C
Nach der Atemkontrolle wird unmittelbar mit den Beatmungen begonnen. Dazu verwendest du idealerweise eine Pocketmaske, die du mit dem doppelten C-E-Griff verwendest (Abb. 2) – hast du keine solche Beatmungsmaske dabei, wendest du die klassische (aber weniger effiziente) Mund-zu-Mund Beatmung an: Es werden fünf Initial-Beatmungen durchgeführt (die Erklärung dafür ist ident mit der bei einem Ertrinkungs- bzw. Kinder-Notfall, denn der Patient hat v.a. das Problem von Sauerstoffmangel in B; siehe bergundsteigen #101).

Ist nach der fünften Beatmung dein Partner bereit für die Thorax-Kompressionen, werden diese mit 30 Wiederholungen gestartet (und die CPR nach BLS im Rhythmus 30:2 fortgesetzt; siehe bergundsteigen #100). Nach einer Lawinenverschüttung ist auf der Schneeoberfläche oft aber keine gute und somit effiziente Thorax-Kompression möglich, weil dazu zwingend ein fester und harter Untergrund notwendig ist.
Je nach der Schneebeschaffenheit kann es notwendig sein, die freigeschaufelte Rampe durch „Trampeln“ zu verdichten oder mithilfe umgedrehter Skier eine entsprechende Unterlage zu bauen – währenddessen wird der Patient im Verschüttungsraum weiter beatmet und zwar solange bis die Kollegen mit der harten Unterlage bereit sind.
Dann wird der Patienten so schnell wie möglich vom VR auf die Unterlage/Rampe gehievt, wobei die Beatmung kurz unterbrochen werden muss. Nun wird ganz normal mit 30:2 CPR reanimiert, wofür drei Personen eine ideale Teamgröße sind: Der „Beatmer“ an der Kopfposition behält den Überblick und feedbacked die „Drücker“, die sich alle zwei Minuten abwechseln und deren Motto „Hard & Fast“ lautet (siehe bergundsteigen #99).
Eine gute CPR läuft koordiniert ab, hat nur zum Beatmen Unterbrechungen in der Thorax-Kompression und wird kontinuierlich durchgeführt. Sollte die Pistenrettung oder andere organisierte Helfer vor dem Eintreffen des Rettungshubschraubers verfügbar – oder ein Defi-Standort in der Nähe – sein, nutzen wir zur Überbrückung einen AED (Automatisierten externen Defibrillator).
Bei jeder CPR soll ein AED verwendet werden (siehe Paal in bergundsteigen #101).
ECLS
ist ein Akronym für Extracorporeal Life Support, zu deutsch extrakorporale Lebensunterstützung. Der etwas präzisere Begriff lautet extracorporale Membranoxygenierung, kurz ECMO. Hinter die – sen Begriffen steht ein extrakorporales Organersatzverfahren, dass die Funktion der Lunge eine Zeit lang übernehmen kann, wenn diese schwer beeinträchtigt ist.
Die Funktion der Lunge ist der Gasaustausch, also die Anreicherung des Blutes mit Sauerstoff und die Abgabe von Kohlenstoffdioxid aus dem Blut in die Umwelt. Die ECLS-Maschine besteht aus einer Membran und meist einer Pumpe. Für das Verfahren wird in ein großes Blutgefäß des Patienten eine Leitung eingebracht, die das Blut zur Maschine führt.
Dort strömt es an der Membran vorbei, wo dann der Gasaustausch stattfindet, bevor es wieder – reich an Sauerstoff und arm an Kohlenstoffdioxid – zurück in ein großes Blutgefäß geleitet wird. Neben stabilen Sauerstoff- und Kohlenstoffdioxidverhältnissen wird der Lunge des Patienten so die Arbeit abgenommen und sie kann sich auf den Heilungsprozess konzentrieren.
Fakten! Mythen?
Zum Thema Lawinenverschüttung gibt es einige Mythen, die sich tapfer halten und von Kurs zu Kurs weitergegeben werden … Auf diese möchten wir hier nicht wirklich eingehen, sondern lieber ein paar Fakten aufzählen:
- CPR immer starten, außer: Gefahr für Retter; Körper durchgefroren (bei Kameradenrettung unwahrscheinlich) oder Verletzungen, die nicht mit dem Leben vereinbar sind, z.B. durchtrennter Körperstamm oder Kopf ab (siehe Paal in bergundsteigen #80, Entscheidungskriterien für den Abbruch einer kardiopulmonalen Reanimation).
- Die Frage nach weiterer Versorgung (ECLS) ist nicht Aufgabe der Ersthelfer (BLS-Anwender).
- Triple-H-Syndrom: günstige Faktoren für das Outcome des Patienten sind Hypoxie (Sauerstoffmangel), Hypothermie (Kälte) und Hyperkapnie (hohes CO2 im Blut).
- Weitere Unterkühlung/weiteres Auskühlen ist unbedingt zu vermeiden.
- (Kälte-)Zittern gilt als Gefahrenzeichen, kein Zittern ist ein absolutes Alarmzeichen.
- Unterkühlte Patienten dürfen bewegt werden, wenn dies für weitere Maßnahmen erforderlich ist → achsengerecht und inline arbeiten (siehe ERC 2015).
- Eine „Atemhöhle“ wird nicht beurteilt, sondern nur, ob die Atemwege (Mund-/ Rachenraum) frei von Schnee/Eis sind, d.h. ob eine Atmung möglich war. Unabhängig davon arbeitest du aber ganz normal nach ABCDE weiter und bei der Übergabe an die professionellen Retterinnen beschreibst du, was du in A und B tun musstest, um beatmen zu können.
- Für die CPR muss der Patient in Rückenlage auf hartem Untergrund liegen, d.h. für das Drücken ist ein stabiler Arbeitsplatz wichtig. Überbrückend den Patienten nur beatmen → lieber verzögert mit der Kompression starten als ineffizient drücken (vgl. ERC).

ALS und Hopescore
Eine zentrale Aussage lautet: Eine gute und umfangreiche BLS-Versorgung (Basic Life Support) ist die Grundvoraussetzung für alle (weiteren) ALS-Maßnahmen (Advanced Life Support)! D.h. die Qualität deiner BLS-Maßnahmen ist mitentscheidend, ob die eintreffenden professionellen Rettungskräfte die Behandlung aufbauend fortsetzen können (ALS) oder ob sie Verabsäumtes nachholen bzw. korrigieren müssen.
Konkret heißt das: invasive Maßnahmen können v.a. dann gut und sicher von der Med-Crew des Helikopters durchgeführt werden, wenn z.B. eine kontinuierliche Thorax-Kompression von den a Ersthelfern erfolgte. Auch ermöglicht eine gute BLS, dass sich bspw. der Arzt einen guten gesamten Überblick verschaffen und bei mehreren Patienten eine Sichtung vornehmen kann.
- ALS (Advanced Life Support) beinhaltet die Maßnahmen der erweiterten Patientenversorgung durch Rettungs- und Notarztdienst bzw. Klinik. ALS baut auf BLS (Basic Life Support) auf, somit ist eine funktionierende BLS Voraussetzung für ALS.
- HOPE Score: in der Schweiz entwickelter „Hypothermia Outcome Prediction after Extracorporeal Life Support Score“ gibt Auskunft über die Überlebenswahrscheinlichkeit von Patienten mit Herz-Kreislauf-Stillstand bei Hypothermie unter Berücksichtigung von Alter, Geschlecht, Hypothermie mit Asphyxie und HKL-Stillstand bei Bergung oder ohne Asphyxie, Reanimationsdauer, Serumkaliumspiegel und Körperkerntemperatur
- Vollständige Leitlinien zum Kreislaufstillstand unter besonderen Umständen bietet das GRC (German Resuscitation Council, Deutscher Rat für Wiederbelebung)
- Messung der Körperkerntemperatur ist präklinisch eigentlich nur über eine Messung im Magen aussagekräftig. Es bietet sich aber an, über die Dauer der Verschüttung eine Schätzung der Körperkerntemperatur (KKT) vorzunehmen: ab 60 min Verschüttungsdauer KKT < 30°C


Erläuterungen zum Algorithmus
1) Patienten komplett vom Schnee befreien, es gibt aber keinen Grund ihn aus dem VR („Loch“) zu zerren (Kä lte, Verletzungen); eine Betreuung ist sehr wichtig.
2) Entscheidend ist hierbei das Vorhandensein von Schutzreflexen; i.d.R. sind diese bei einer ausschließlichen Reaktion auf Schmerzreize (festes Zwicken) als unzureichend einzustufen (GCS < 9). Wach („Augen offen“) und desorientiert (GCS > 13) hat auf die Schutzreflexe jedoch keinen negativen Einfluss.
3) Mund und Nase von Schnee/Erbrochenem befreien, Kopf (inline) überstrecken (Chinlift)
4) Atemfrequenz (AF) zwischen 9-29/min? Brustkorb hebt/senkt sich seitengleich & deutlich?
5) Liegt der Patient seitlich oder in Rückenlage und (!) lässt sich AB gut handhaben, kann schnell aber schonend (inline/achsengerecht) gearbeitet werden; falls AB schwierig ist oder eine akute Verschlechterung eintritt (CPR) → Sofortrettung
6) Patient muss in Rückenlage auf hartem Untergrund liegen, für das Drücken ist ein stabiler Arbeitsplatz wichtig; überbrückend den Patienten nur beatmen → besser verzögert mit der Kompression starten als ineffizient drücken (vgl. ERC).
Prinzipien
10 Sekunden für die nächsten 10 Minuten (Keep it simple & stupid).
- Jeder Verschüttete gilt bis zum Beweis des Gegenteils als verletzt.
- Der Kopf (A) und Thorax (B) müssen schnell freigelegt werden.
- Wärmeerhalt hat einen sehr hohen Stellenwert, Hypothermie muss vermieden werden (Gerinnung). ❙ Bei Kameradenrettung, sobald/wenn irgendwie verfügbar, AED verwenden.
- CPR: Feedbackschleife einbauen und im 3er-Team arbeiten: Helfer 1 ist am Kopf (Beatmung, A/B), Helfer 2 und 3 wechseln alle zwei Minuten (Kompression, C).
- Beatmung (idealerweise mit Pocketmaske) hat einen sehr hohen Stellenwert (ähnlich Ertrinkungs-, Kindernotfall).
- Schwere Verletzungen und SHT sind wahrscheinlich, Lawinenkontext beachten (Sturzbahn, Felsen, Bäume …).
- Blutungen stoppen, ggf. Blutungsräume komprimieren (Beckenschlinge).
- Bekannte Tools wie „Struktur“, „Kommunikation“, „Organisation“ aus der Verschüttetensuche in die Erste Hilfe übernehmen (ABCDE).
Danke an Markus Thaler, Bene Treml, Hubsi Haberfellner, Sebastion Zipplies & Peter Paal.
Quellen
- Pasquier, M. et al: HOPE-Score, https://www.hypothermiascore.org/
- ICAR avalanche victim resuscitation checklist
- Truhlar, A. et al.: European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation, 2015 Section 4. Cardiac arrest in special circumstances
- Peter Paal et al: Akzidentelle Hypothermie – Lawinenmedizin, ÖAZ 2015
- Paal, Beikircher, Brugger: Der Lawinennotfall – eine aktuelle Übersicht, Anaesthesiest 2006