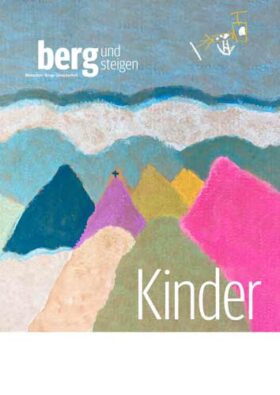Wie entsteht eine Lawinenvorhersage? Teil 3/3: Die Gefahrenstufe
Aus dem vorangegangenen Teil der Serie wissen wir, dass Lawinenprognostiker:innen jedes Lawinenproblem im Rahmen eines einheitlichen Workflows anhand der drei für die Lawinengefahr maßgeblichen Parameter beurteilen.
Aus diesen drei Parametern wird im Anschluss die Gefahrenstufe festgelegt – und auch dieser Prozess folgt einem einheitlichen, von der europaweiten Arbeitsgruppe der Lawinenwarndienste ausgearbeiteten Konzept.

Das zentrale Werkzeug dieses Konzepts ist eine – oder besser gesagt drei Matrizen: Sie legen für jede Kombination der drei Parameter eine resultierende Gefahrenstufe fest. Die sogenannte EAWS-Matrix dient der Vereinheitlichung der ausgegebenen Lawinengefahrenstufe der verschiedenen Warndienste und soll subjektive Einflüsse bei der Erstellung der Lawinenvorhersage möglichst ausschließen.
Die Verwendung der Matrix

Um zu verstehen, wie die Lawinenprognostiker:innen die Matrix verwenden, gehen wir noch einmal zurück zum ersten Berichttag der Saison 2024/25. Am 07. Dezember 2024 hatte Patrick Nairz das ausgegebene Triebschneeproblem mit der Schneedeckenstabilität schlecht beurteilt – die Triebschneepakete ließen sich schon von einzelnen Wintersportlern mit geringer Zusatzbelastung auslösen ließen.
Um nun die passende Gefahrenstufe zu ermitteln, wählte er die mittlere der drei Matrizen aus. Er ging außerdem davon aus, dass es an diesem Tag nur wenige solcher Gefahrenstellen mit schlechter Schneedeckenstabilität gab. Für die Gefahrenstufe rutschte er damit in die dritte Zeile der mittleren Matrix. Zu guter Letzt erwartete Patrick sich für den ersten Berichttag maximal Lawinen der Größe 2 – mittel.
Das führte ihn zum rechten, gelben Feld und der Gefahrenstufe 2 – mäßig. Mit derselben Herangehensweise ermitteln Lawinenprognostiker:innen täglich die Gefahrenstufen für jedes angegebene Lawinenproblem. Die resultierende, höchste Gefahrenstufe wird am Ende im Lawinenlagebericht kommuniziert.

Die Entstehung der Matrix
Die aktuelle EAWS-Matrix wurde mithilfe einer Umfrage unter 76 europäischen Prognostiker:innen erstellt. Den Prognostiker:innen wurde dazu eine leere EAWS-Matrix vorgelegt – sie sollten nach ihrem Verständnis der Lawinengefahr jeder Kombination aus Schneedeckenstabilität, Häufigkeit der Schneedeckenstabilität und Lawinengröße eine passende Gefahrenstufe zuordnen.
Auch für eine(n) erfahrene(n) Lawinenprognostiker:in stellt das keine einfache Aufgabe dar. Das Ergebnis der Umfrage ist die, seit 2022 bestehende EAWS-Matrix, wie sie weiter oben abgebildet ist. Die erste Zahl im jeweiligen Feld steht dabei für die am Häufigsten von allen Prognostiker:innen gewählte Gefahrenstufe.
Die Zahl in Klammern kommt dazu, wenn sich die europäischen Prognostiker:innen nicht ganz einig in ihren Antworten für das jeweilige Feld waren – sie stellt die Tendenz des Feldes dar: die meisten Warner:innen sehen beispielsweise eine Kombination aus schlechter Schneedeckenstabilität, einigen Gefahrenstellen und Lawinengröße 2 als mäßige Lawinengefahr (2) an.
Einige von ihnen tendieren jedoch auch zu erheblicher Lawinengefahr (3), weshalb diese Zahl in Klammern angegeben ist. Um subjektive Einflüsse bei der Erstellung der Gefahrenstufe auszuschließen, haben sich die Prognostiker:innen darauf geeignet, wenn möglich, die als erstes angegebene Gefahrenstufe zu kommunizieren: Patrick kann im Interface des LWD Tirol über Schieberegler die drei Parameter Schneedeckenstabilität, Häufigkeit der Gefahrenstellen und Lawinengröße festlegen und das System kommuniziert im Lawinenreport automatisch die aus der EAWS-Matrix resultierende Gefahrenstufe.
Die Warner:innen können die Gefahrenstufe im Nachhinein manuell überschreiben, also statt der ersten die in Klammern angegebene Gefahrenstufe ausgeben. Im Sinne der Konsistenz sollte dies jedoch nur in Ausnahmefällen geschehen.
Was sagt uns die resultierende Gefahrenstufe?
Was bedeutet das alles nun für die Gefahrenstufe? Es ist wichtig festzuhalten, dass – wie so vieles in unserer Welt – auch die Gefahrenstufenskala ein von uns Menschen erfundenes System ist. Und als solches ist sie weder in Stein gemeißelt (die aktuelle EAWS-Matrix gibt es schließlich überhaupt erst seit 2022 und es wird ständig daran gearbeitet, sie weiterzuentwickeln), noch perfekt.
Und dennoch ist die Gefahrenstufe – richtig verwendet – ein sehr mächtiges Instrument. Sie bildet immerhin den geballten Wissens- und Erfahrungsschatz der europäischen Lawinenprognostiker:innen ab.

Was bedeutet das noch für die Gefahrenstufe? Es bedeutet auch, dass zwei voneinander sehr unterschiedliche Lawinensituationen zur gleichen Gefahrenstufe führen können. Mit Blick auf die oben abgebildete Matrix sehen wir, dass zum Beispiel eine typische, tief liegende Altschneeschwachschicht zur gleichen Lawinengefahrenstufe führen kann, wie eine Situation mit frischem, leicht auslösbarem Triebschnee. Gehen wir dazu etwas ins Detail und vergleichen zwei fiktive Situationen.
Zwei sehr unterschiedliche Situationen führen zu gleichen Gefahrenstufe
Die fiktive Situation Nummer eins (Altschneeproblem) spielt sich in der zweiten Winterhälfte ab. Die Schneedecke ist mittlerweile recht mächtig und überdeckt dabei eine tiefliegende, persistente Schwachschicht vom Frühwinter. Die Schneedeckenstabilität für dieses Altschneeproblem ist mit mittel zu bewerten – nur mehr mit großer Zusatzbelastung können Wintersportler die tiefliegende Schwachschicht stören und somit Lawinen auslösen.
Es gibt auch nur noch wenige Gefahrenstellen, an denen es überhaupt möglich ist, die Schwachschicht zu stören: einzig dort, wo wenig Schnee liegt, besteht die Gefahr noch. Wenn Lawinen aber ausgelöst werden, können sie groß (Größe 3) werden. Die resultierende Gefahrenstufe ist mäßig (2). Situation Nummer zwei (Triebschneeproblem) können wir uns wie folgt vorstellen: es hat in der letzten Woche wenige Zentimeter geschneit – der Neuschnee ist windberuhigt gefallen und liegt locker auf der stabilen Altschneedecke – er stellt damit eine potentielle, zukünftige Schwachschicht dar.
In der Nacht auf den morgigen Tag setzt nun starker Wind aus wechselnden Richtungen ein und verfrachtet den wenigen, lockeren Schnee. Es entstehen Triebschneepakete, die an vielen Stellen im Gelände leicht von einzelnen Wintersportler:innen auszulösen sind (Schneedeckenstabilität schlecht). Die Größe der resultierenden Lawinen ist jedoch klein (Größe 1) – an der Schneeoberfläche liegt nur wenig verfrachtbarer Schnee. Auch diese Situation führt uns zur Gefahrenstufe mäßig (2).

Wenn wir nun in beiden Situationen ausschließlich auf die Gefahrenstufe achten, gehen für unser Verhalten im Gelände essentielle Informationen verloren. Erst wenn wir die Gefahrenstufe in Kombination mit dem zugehörigen Lawinenproblem und den zugrunde liegenden Beurteilungs-Parametern verstehen, können wir praktische Verhaltensregeln für unseren Tag im Gelände ableiten. In unseren zwei Beispielen könnte das wie folgt aussehen:
Situation 1: Lawinengefahr mäßig (2), Altschneeproblem, Schneedeckenstabilität: mäßig, Gefahrenstellen: wenige, Lawinengröße: groß
Die Wahrscheinlichkeit, Lawinen auszulösen ist zwar gering, die potentiellen Konsequenzen im Falle einer Auslösung sind jedoch sehr hoch: Lawinen können groß werden und als Skifahrer:in ist die Chance, Lawinen dieser Dimension zu überleben, gering. Wer dieses Risiko nicht eingehen möchte, meidet konsequent größere Steilhänge und Geländefallen in den angegebenen Expositions- und Höhenbereichen sowie Übergänge von wenig zu viel Schnee.
Situation 2: Lawinengefahr mäßig (2), Triebschneeproblem, Schneedeckenstabilität: schlecht, Gefahrenstellen: viele, Lawinengröße: klein
Lawinen können an diesem Tag leicht und an vielen Stellen ausgelöst werden. Aber: sie bleiben klein (Größe 1). Die Verschüttungsgefahr bei kleinen Lawinen ist gering. Wer also nicht alleine (wo auch eine Teilverschüttung reichen kann, um sich in ernsthafte Gefahr zu bringen) oder im absturzgefährdeten Gelände unterwegs ist, kann bei einer Lawinenauslösung mit geringen Konsequenzen rechnen. Zudem sind die Triebschneepakete gut erkennbar und können gemieden werden.

Was wir daraus lernen können
Die Gefahrenstufenskala ist ein mächtiges Werkzeug für die Lawinenprognose, doch sie allein reicht nicht aus, um Gefahr und Konsequenzen im Gelände richtig einzuschätzen. Erst wenn wir die Gefahrenstufe in Kombination mit dem ausgegebenen Lawinenproblem und im besten Fall zusammen mit den ausgegebenen Beurteilungs-Parametern verstehen, können wir verantwortungsbewusst handeln – vor und auf der Tour.