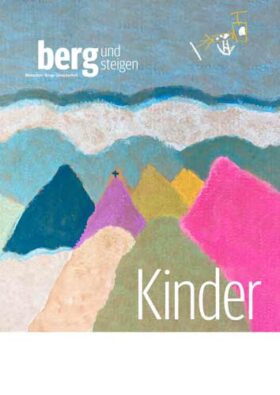Risiko beim Bergsteigen: Von Felsklippen und anderen Unsicherheiten
No risk – NO FUN, Risiko-FREUDE, Risiko-SCHEU, Risiko-SPORT, REST-Risiko, Risiko-MANAGEMENT: Begriffe, die in unserer Gesellschaft Eingang in den allgemeinen Sprachgebrauch gefunden haben. Die Risiko-EINSCHÄTZUNG in einer konkreten Situation bleibt dabei in den allermeisten Fällen eine sehr individuelle, von verschiedenen persönlichen und situativen Faktoren abhängige und nicht selten „fluide“ Sache.
Eine solche Einschätzung mussten schon die antiken und mittelalterlichen Seefahrer treffen, wenn sie eine Klippe (alt-italienisch „risco“) umsegeln mussten (lateinisch „risicare“). Insofern war es im damaligen Sprachgebrauch zumindest schon angelegt, dass der Begriff Risiko mit einer gewählten Entscheidung und dem bewussten Wagnis zu einer Handlung zu tun hat (auch wenn damals die Entscheidungsspielräume generell viel kleiner waren als heute).
Das unterscheidet das Risiko von einer Gefahr, die nur eine Sachlage beschreibt, die das Potential einer schädlichen Wirkung hat (z. B. ein loser Felsblock in einer Wand), aber für uns erst durch unser Handeln zum Risiko wird (z. B. wenn wir in der Wand klettern). Grundsätzlich stellt sich die Frage, warum Menschen überhaupt Risiken eingehen und sich absichtlich in gefährliche Situationen begeben.

Warum begibt sich der Mensch ins Hochgebirge, in die überhängende Felswand oder in die lawinengefährdete Steilflanke und setzt sich dadurch Unsicherheiten und Risiken aus? Erklärungen dazu lassen sich in der Soziobiologie, der Psychologie und anderen verwandten Disziplinen finden.
Motivationsforschung: Risiko und Bedürfnisse
Eine sehr nachvollziehbare Deutung liefert die Betrachtung aus der Perspektive unserer menschlichen Bedürfnisse: In unserer modernen westlichen Wohlstandsgesellschaft besteht ein vergleichsweise geringes objektives Lebensrisiko für den Einzelnen. Wir werden derzeit zumindest nicht direkt von Kriegen bedroht, die Kriminalitätsrate ist vergleichsweise gering, Hungersnot ist faktisch nicht vorhanden. Unsere existenziellen Bedürfnisse sind befriedigt.
Uns friert nicht und den Kampf auf Leben und Tod kennen wir nicht. Weil unsere existenziellen Bedürfnisse meist befriedigt sind, richtet sich unsere Motivation auf die weiter oben in der Bedürfnishierarchie (nach Abraham Maslow, 1908–1970) stehenden, kognitiv und emotional anspruchsvolleren sogenannten Wachstumsbedürfnisse aus: wichtig sein, Macht, Einfluss, Erfolg, Wertschätzung, Prestige, Freiheit und schließlich Selbstverwirklichung als (nie ganz abgeschlossene) Suche nach Entfaltung der eigenen Talente und Potentiale.
Im Hochgebirge suchen wir Herausforderung und Flow. Dort können wir uns aber auch in gewissermaßen künstliche, nicht an existenzielle Bedürfnisse gebundene Risikosituationen begeben, die wir uns selber aussuchen (Freiheit). Das führt zur Stimulation, einerseits direkt durch Hormonausschüttung, andererseits indirekt durch soziale Anerkennung (Wertschätzung). Held zu sein bedeutet einen hohen sozialen Rang und bringt Ansehen. Es unterstreicht die eigene körperliche Fitness (Entfaltung eigener Talente) und macht attraktiv (Prestige). Damit lässt sich auch der Boom der Risikosportarten begründen, der heutzutage auf weitaus höhere Akzeptanz als noch vor 20, 30 Jahren trifft.

Soziobiologie: Suche und Erkundung
In der Soziobiologie sucht man nach dem Sinn von riskantem Verhalten. Es wird versucht, die Notwendigkeit riskanter Situationen zu begründen. Risiko wird dabei als Teilaspekt des elementaren emotionalen Steuermechanismus „Suche und Erkundung“ beschrieben. Dabei kommt dieser emotionalen Steuerung neben anderen die Aufgabe zu, die Fortpflanzung und Lebenserhaltung von Organismen in komplexen Umwelten zu sichern.
So dient jene „Suche und Erkundung“ dem Erschließen neuer Lebensräume, ist aber auf der anderen Seite mit großen Risiken verbunden. Gesteuert wird diese Emotion vor allem über den Neurotransmitter Dopamin. Bei Versuchen mit Ratten und Affen sind nicht alle Mitglieder einer Gruppe gleichermaßen an dieser riskanten Erkundungstätigkeit beteiligt. Insbesondere die jungen männlichen Mitglieder, die noch nicht „Chef“ sind, agieren in jenem Bereich und sprechen auf Dopamin stark an.
Ähnlich findet man in Extremsportarten unserer Gesellschaft zu einem großen Teil junge Männer, die sich durch das Spiel mit dem Risiko mehr oder weniger bewusst beweisen, bestätigen und sich daran erfreuen. Sich einem Risiko auszusetzen, ermöglicht uns insofern die Rückkehr in unsere evolutionäre Vergangenheit und beschert uns gleichzeitig Lebensfreude.
Bergsteigen ist bei allen Risiken die herrlichste Nebensache der Welt.
Mathematik: Wahrscheinlichkeitstheorie
Eine andere Bedeutung von Risiko begegnet uns beispielsweise an der Börse. Wirtschaftswissenschaftler und Mathematiker beschreiben das dort anzutreffende Risiko aus dem Blickwinkel der Wahrscheinlichkeitstheorie. Somit ist Risiko die Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmtes Ereignis mit negativen Auswirkungen während einer festen Zeitperiode eintritt oder aus einer bestimmten Handlung resultiert.
Die Entwicklung unserer Fähigkeiten im Umgang mit Risiken wird als entscheidende Komponente der Gesellschaftsentwicklung vom Altertum bis heute beschrieben. Einfach gesprochen, säßen wir noch immer in der steinzeitlichen Höhle, wenn wir nicht unsere Fähigkeit im Umgang mit Risiken verbessert hätten. Der Risikobegriff ist eng mit der Wahrscheinlichkeitstheorie und somit der Entwicklung der Zahlen vor dem jeweiligen kulturellen und gesellschaftlichen Hintergrund verknüpft.
Voraussetzung für diese Betrachtungsweise ist aber, dass sich das Risiko an objektiven Variablen wie Eintrittswahrscheinlichkeit – mit welcher Wahrscheinlichkeit kommt es zur Katastrophe – und Schadenserwartung – welches Ausmaß wird die Katastrophe haben – festmachen lässt. Vor allem im Bereich des Risikomanagements bei Banken, Versicherungen und Industrie haben heute computergestützte Entscheidungssysteme den „fehlerhaften“ Menschen abgelöst, insbesondere wenn die zu berücksichtigende Datenmenge unüberschaubar wird.

Entscheidungstheorie
In der Psychologie wird der Umgang mit Risiken und Risikosituationen als Entscheidungsproblem aufgefasst. Nicht die Wirkung oder das Ausmaß eines Risikos ist entscheidend, sondern die Herangehensweise, der Umgang damit, das Verhalten vor und in der Risikosituation. So hatte die Entwicklung der Konzepte zur künstlichen Intelligenz seit Ende der 1960er-Jahre die Erschaffung einer fehlerfrei arbeitenden Intelligenz zum Ziel, die nicht von der Tagesverfassung und anderen Unwägbarkeiten in ihrer Leistung und Genauigkeit beeinflusst wird.
In der Gegenposition der 1970er-Jahre wurde dann die Fähigkeit des Menschen als denkende und fühlende Intelligenz im Gegensatz zum Computer unterstrichen. In den 1980er-Jahren wurde die Bedeutung von individuellen Vorstellungen und Werten als Grundlage bei Entscheidungen und Risiko zunehmend anerkannt. Unterschiedliche Wahlmöglichkeiten bei verschiedenen Risikosituationen, je nach Zielvorstellungen und Werten des Entscheiders, wurden postuliert.
Intuition, sechster Sinn und Erfahrung als wichtige Basis für die Qualität von Entscheidungen und Risikoabschätzung sind zurzeit Forschungsgegenstand. So trifft ein Großmeister im Simultanschach seine Zugentscheidungen quasi „aus dem Bauch“. Er erfasst die Situation, das Bild auf dem Brett in seiner Gesamtheit, vergleicht es unbewusst und ohne große Denkarbeit mit schon gesehenen Bildern und früher erlebten Partien und macht seinen nächsten Zug, ohne lange die Vor- und Nachteile abzuwägen.
Dopamin: Das Spiel mit dem Risiko erfüllt und erfreut.
7 Widersprüche und Paradoxien im Umgang mit Risiken

1. Risiko versus Versicherungsmentalität
Wir haben die Popularität der „Risikosportarten“ (zu denen auch der Bergsport gehört) bereits angesprochen. Es gibt definitiv eine steigende Anzahl von Menschen, die Risikosportarten ausüben und sich für Aktivitäten wie Fallschirmspringen, Bungee-Jumping, Klettern, Mountainbiken und andere „Adrenalinsportarten“ begeistern.
Gleichzeitig gibt es aber auch eine zunehmende Versicherungsmentalitä t und ein Bestreben, möglichst alle Eigenverantwortung (z. B. durch Nutzung von Technik wie GPS-Navigation, Lawinen-Airbags oder Inanspruchnahme von entsprechenden Dienstleistungen wie z. B. Bergsportanbietern) abzugeben. Das Bewusstsein des eigenverantwortlichen Umgangs mit Risiken nimmt ab. Einerseits ist also das Eingehen von bestimmten Risiken gesellschaftlicher Trend und ein Ausdruck des Bestrebens, das „Freiheitsbedürfnis“ (siehe oben) zu befriedigen.
Andererseits können das Mitschwimmen im Risikosportartentrend und die Versicherungsmentalität auch nur eine Scheinbefriedigung sein. Vielleicht sind sie genau das Gegenteil von Freiheit und reduzieren sogar unseren freien Willen und unsere Selbstständigkeit.
2. Eingangs- versus Basis- versus Restrisiko
In der Kommunikation über Risiken, zum Beispiel während der Diskussion über eine bestimmte Tour, sind Missverständnisse oft auf die „Widersprüche“ beziehungsweise Unterschiede zwischen Eingangs-, Basis- und Restrisiko zurückzuführen.
Das Basisrisiko ist das Risiko aus den unbeeinflussbaren Faktoren einer Tour: Wetter, Lawinenlage oder Gelände. Diese Faktoren können wir nicht beeinflussen und müssen wir akzeptieren. Das Eingangsrisiko kommt zum Basisrisiko dazu und entsteht aus den beeinflussbaren Faktoren: Beispiele sind persönliches Können, Ausrüstung, zeitliche und räumliche Tourenplanung.
Je komplexer die Tour, desto höher sind Basis- und Eingangsrisiko (z. B. Weißhorn-Überschreitung versus Hallenklettern). Durch unser Verhalten können wir nun aber das Eingangsrisiko reduzieren. Es verbleibt dann noch das Restrisiko. Dieses ist aber immer höher als das Basisrisiko, das sich nicht reduzieren lässt.
3. Glorifizierung versus Schuldsuche
Professionelle Risiko-Protagonisten, Extrembergsteiger und Alpinathleten werden bewundert, gelikt, „gefollowed“ und geklickt. Bei Unfällen bricht aber sofort die Verurteilungswelle auf sie herein – sowohl in der konventionellen Presse als auch in den sozialen Netzwerken. Dabei hat häufig nur das unwahrscheinliche letzte Quäntchen Restrisiko zugeschlagen, wie es das schon immer getan hat.
4. Terroranschlag versus Wohnungsbrand
Risikowahrnehmungen können sehr unterschiedlich sein und sind nicht selten ungerechtfertigt, weil sie der tatsächlichen Eintrittswahrscheinlichkeit nicht entsprechen. Das Risiko, Opfer eines tödlichen Terroranschlags zu werden, wird beispielsweise laut einer Umfrage um das 30-Fache überschätzt. Das Risiko, von einem Wohnungsbrand überrascht zu werden, wird dagegen um das 350-Fache unterschätzt.
5. Wissen versus Verhaltensänderung
Nicht selten wissen wir aber sehr wohl um bestimmte Risiken. Allein unser Verhalten zu ändern, fällt schwer, weil eben Veränderungen immer schwer umzusetzen sind: Wir wissen, dass Rauchen gesundheitsschädlich ist, hören aber trotzdem nicht auf. Wir wissen, dass der Hang heute gefährlich ist, fahren ihn aber trotzdem.

6. Risikominderungstechnik versus riskanteres Verhalten
Es ist ein bekanntes (und statistisch oft belegtes) Phänomen, dass Technik, die Risiken reduziert, gleichzeitig zu riskanterem Verhalten führen kann: Eltern gestatten ihren Kindern gefährlichere Spiele, wenn sie mit Ellbogen- und Knieschützern ausgestattet sind, Gurt und Airbag führen zu riskanterem (Auto-)Fahrstil, GPS-Geräte führen eher zu Touren bei schlechter Sicht (und ggf. Lawinengefahr, die dann schlechter einschätzbar ist), gesunde Ernährung verleitet dazu, sich gleichzeitig bei anderer Gelegenheit schlechter zu ernähren, und so weiter und so fort.
Ein Beispiel aus dem Bergsport können wir als Nebenergebnis unserer langjährigen Lawinenunfallstudie (tödliche Unfälle und die Wirksamkeit der Snowcard, siehe z. B. bergundsteigen #98, „Alles Snowcard, oder was?“) präsentieren: Unsere Daten zeigen, dass die geschätzte Hangsteilheit am Auslösepunkt der Lawine bei tödlich verunfallten Personen, die laut Unfallbericht einen Lawinenairbag dabeihatten, größer war. Sprich, der Airbag führt demnach wohl doch dazu, dass steilere Hänge befahren werden. Der Effekt der Risikoreduzierung durch einen Airbag würde gleichzeitig reduziert oder ganz zunichte gemacht.
In der Studie in bergundsteigen #110, „Lawinenairbags & Risikoverhalten“ wurde das nur vermutet. Gleichzeitig nehmen wir aber auch zur Kenntnis, dass in der Ausgabe #125 im Beitrag „Verleiten Lawinenairbags tatsächlich zu riskanterem Verhalten?“ die Autorengruppe (Forschungsgruppe Winter der DAV-Sicherheitsforschung) nicht zu diesem Ergebnis kam. Und dies ebenso auf der Basis empirischer Daten, die allerdings mit einem ganz anderen Ansatz erhoben und interpretiert wurden. Das Thema „Airbag und Risikoverhalten“ darf also weiter für Diskussionen am Hüttentisch sorgen.
7. Risiko versus Verantwortung
Als Leitungspersonen im Bergsport müssen wir uns beim Führen immer mit dem Widerspruch zwischen Risiko und Verantwortung auseinandersetzen. Einerseits wollen wir unseren anvertrauten Gästen etwas bieten (einen Gipfel erreichen) oder unser Team zu einem Ziel führen (z. B. als Leiter eines Bergrettungseinsatzes jemanden retten). Andererseits haben wir Verantwortung und müssen uns mit der Möglichkeit des Scheiterns beziehungsweise mit den Risiken auseinandersetzen.
7 Empfehlungen für den Umgang mit Risikoparadoxien
Im Umgang mit Risiken stehen wir also immer vor bestimmten Widersprüchen und Gegenpolen. Es ist geradezu die Essenz des Risikomanagements, damit ständig umzugehen. Die aufgeführten Widersprüche werden wir nie ganz auflösen können. Und das wiederum (Das ist vielleicht auch ein Paradoxon!) ist auch gut so, denn wir würden sonst die positiven Aspekte von Risiken verlieren: die Chancen, die in ihnen immer (!) liegen, die Möglichkeiten, unsere Selbstentfaltung zu stärken, die Stimulation unserer Suche nach der Entfaltung unserer Persönlichkeit.
Ignorieren können wir sie aber auch nicht. Deswegen haben wir nachfolgend einige allgemeine Empfehlungen und Fingerzeige zusammengestellt, um mit den typischen Gegensätzen, Kontrasten, Zwiespalten und Gegensätzlichkeiten im Umgang mit Risiken umzugehen:
1. Objektivierung und Rationalisierung (Wissen)
Unsere Einschätzung von Eintrittswahrscheinlichkeiten ist meist unzureichend. Dies umso mehr, je komplexer die Situation ist. Unsere Erwartungen spielen dabei eine Rolle, aber auch Trends, Moden, Nachrichten und soziale Medien (siehe „Terroranschlag versus Wohnungsbrand“). Helfen kann hier nur eine möglichst rationale Auseinandersetzung mit den „echten“ Risiken, basierend auf möglichst objektiven Fakten und Daten.
Bergsport-Beispiele: probabilistische Methoden zur Abschätzung des Lawinenrisikos, tatsächliche Haltekräfte von Schlingen und Schnüren, professioneller Wetterbericht statt nur Bauchgefühl. Ist das immer möglich? Nein, gerade im Bergsport natürlich nicht. Häufig fehlen uns Daten. Aber da, wo wir etwas haben, sollten wir es verwenden. Wissen ist ein essentieller Bestandteil vom guten Umgang mit Risiken (bergundsteigen #66, Es irrt der Mensch, solang er strebt). Oder um es mit Warren Buffet (Großinvestor) auszudrücken: „Risiko entsteht, wenn Anleger nicht wissen, was sie tun.“
2. Regeln
Gerade im Paradoxon „Risiko versus Verantwortung“ helfen uns Regeln. Zum Beispiel das „Lawinenmantra“ oder Checklisten zum Klettern in der Halle (Partnercheck etc).
3. Sich selber hinterfragen
Die typischen Schuldzuweisungen an andere („Glorifizierung versus Schuldsuche“) geben immer auch Auskunft über diejenigen, die sie äußern. Grund ist unsere angeborene Ignoranz gegenüber unseren eigenen Verhaltensweisen und Widersprüchen. Je mehr wir uns mit unserer eigenen Motivation („Warum gehe ich bergsteigen?“) auseinandersetzen, desto weniger werden wir bei Unfällen die Schuldfrage stellen.

4. Resilienz und Distanz stärken
Schuldzuweisungen haben oft damit zu tun, dass es schwer auszuhalten sein kann, bestimmten Gefahren, Risiken und Unsicherheiten ausgesetzt zu sein. Helfen kann da die Stärkung der eigenen Resilienz und in der jeweiligen Situation eine gesunde Distanz zum eigenen Tun.
5. Transparenz
Um der Versicherungsmentalität als Tourenführer oder Bergführer etwas entgegenzusetzen, machen wir die Risiken einer geplanten Tour transparent („Eingangs- versus Basis- versus Restrisiko“, „Risiko versus Verantwortung“). Und Transparenz ist in diesem Fall kein Widerspruch zu klarer Führung.
6. Trends hinterfragen
Und schließlich kann es sinnvoll sein, herrschende Trends immer wieder zu hinterfragen – und nicht alles mitzumachen („Wissen versus Verhaltensänderung“). Echte Freiheitssuche verlangt, den eigenen Weg zu suchen und zu gehen. Das kann auch bedeuten, eine bestimmte Tour nicht zu gehen – auch wenn es auf der Hütte andere Gruppen gibt, die die Tour an dem Tag nicht so kritisch sehen. Verzicht ist auch ein „Schaden“, unter Umständen sogar ein sehr persönlicher, der aber in der üblichen Betrachtung des „Schadensausmaßes“ als gewissermaßen objektiver Teilaspekt bei Risikoentscheidungen nicht als solcher gesehen wird. Oder um es noch anders auszudrücken: Es geht darum, die eigene Komfortzone auch einmal zu verlassen und eigenverantwortlich unangenehme, abweichende Wege zu gehen.
7. Schritt-für-Schritt-Lösung
Risiken können uns verunsichern, unter Umständen bis zur Handlungsunfähigkeit und Blockierung aus Angst beziehungsweise Panik. Helfen kann die Konzentration auf das Hier und Jetzt und die Schritt-für-Schritt-Lösung der Situation (statt zu versuchen, die Situation sofort komplett aufzulösen) bzw. die gelassene Akzeptanz der verbleibenden Unsicherheit.
Trotz allem aber: Bergsteigen macht Spaß, und ein gewisses Risiko gehört dazu! Oder um es mit Carl Amery (*1922, †2005; Schriftsteller) zu sagen:
„Risiko ist die Bugwelle des Erfolgs.“